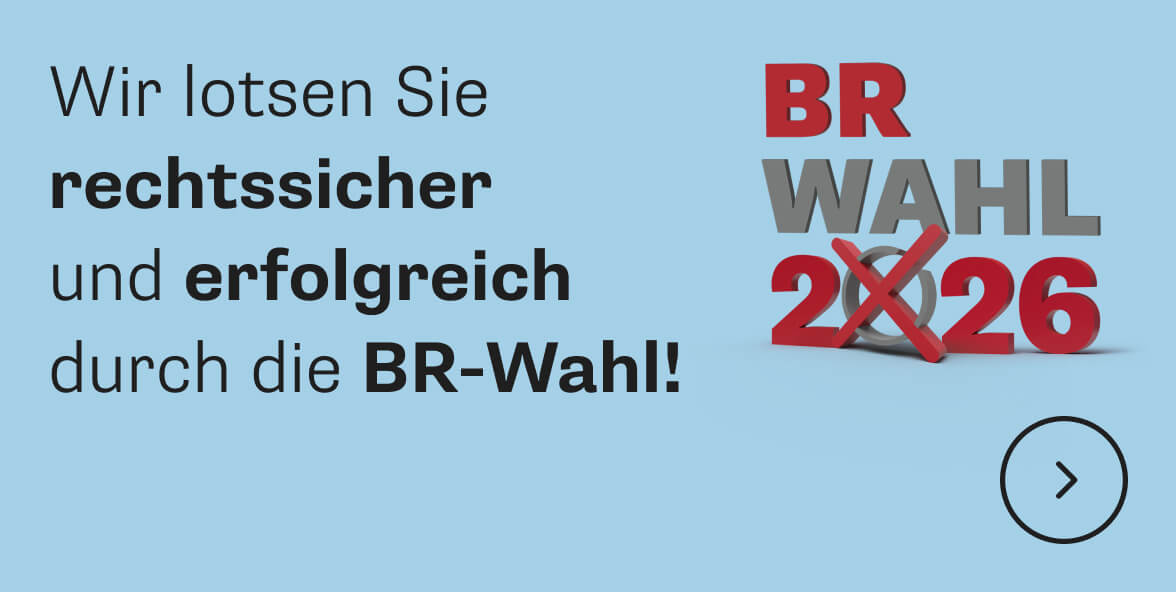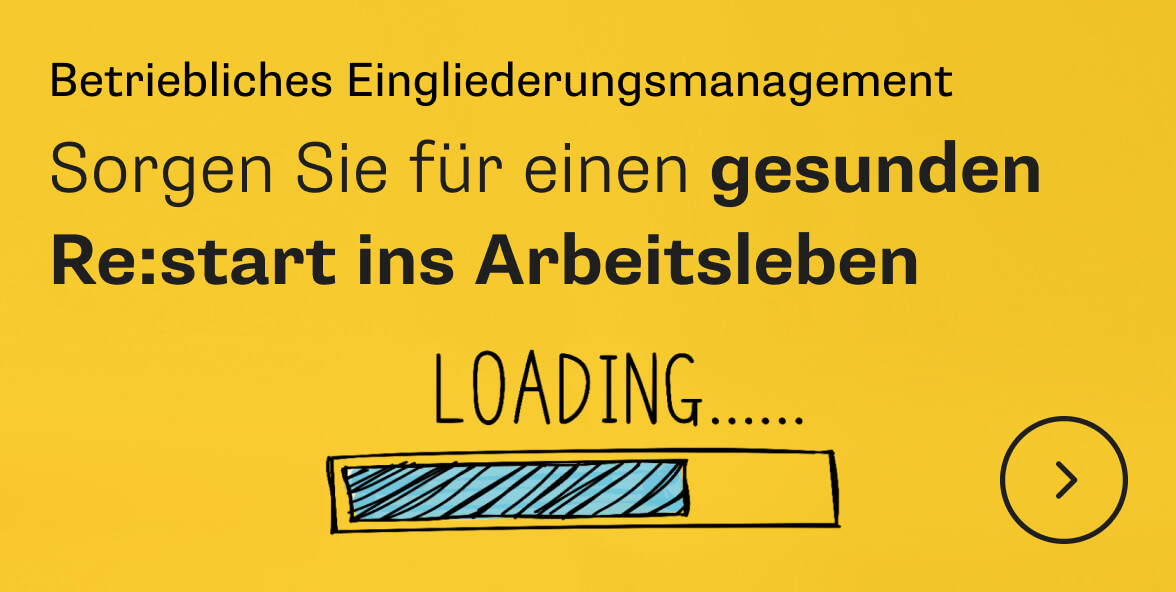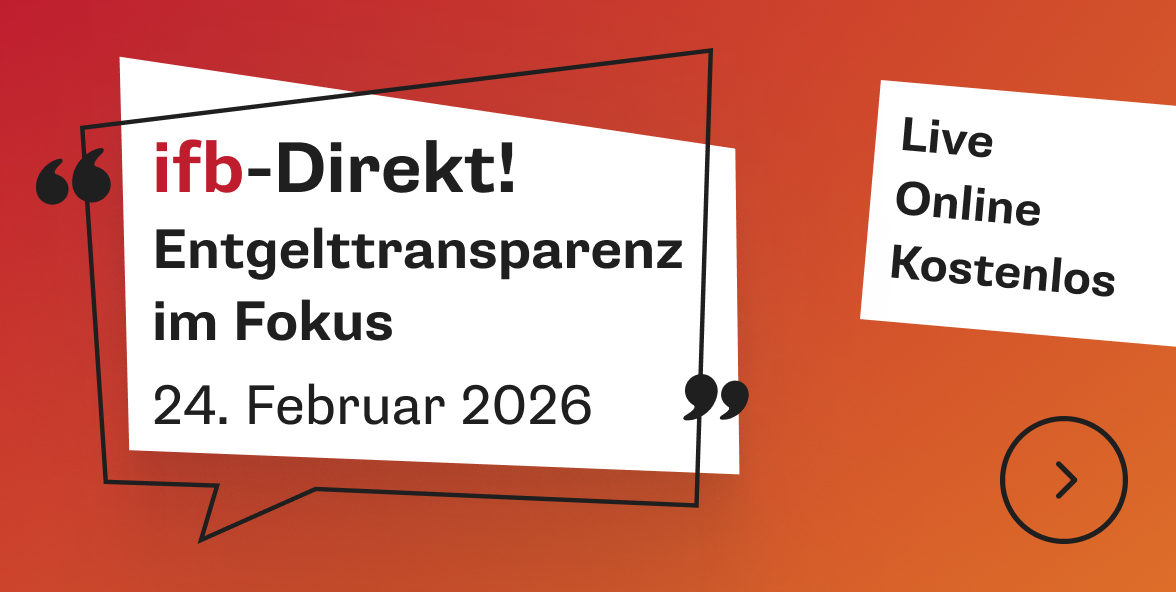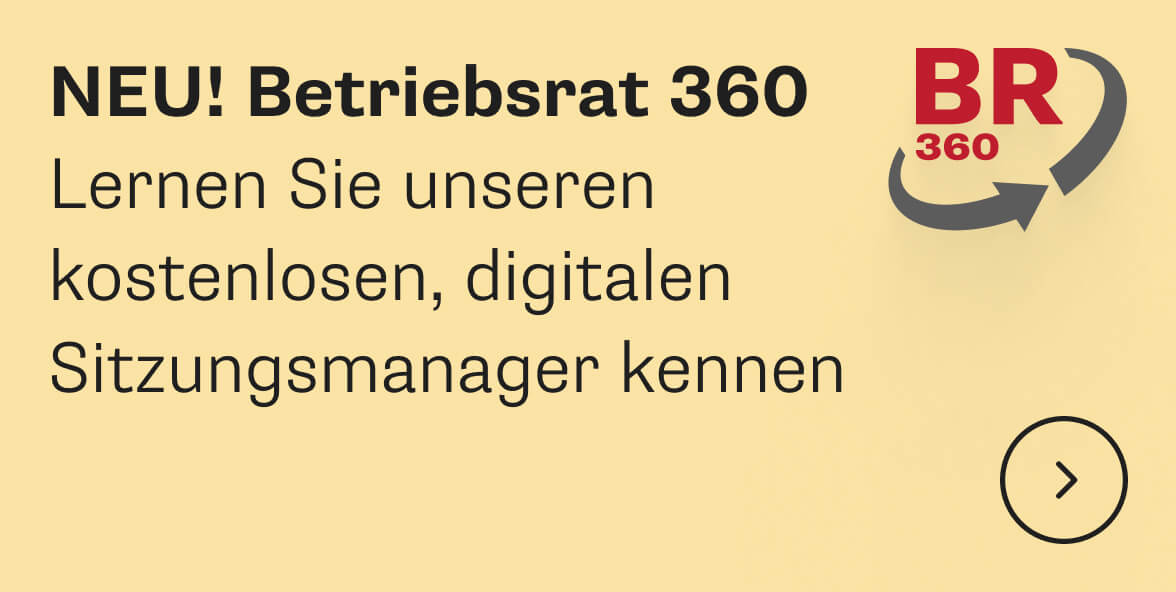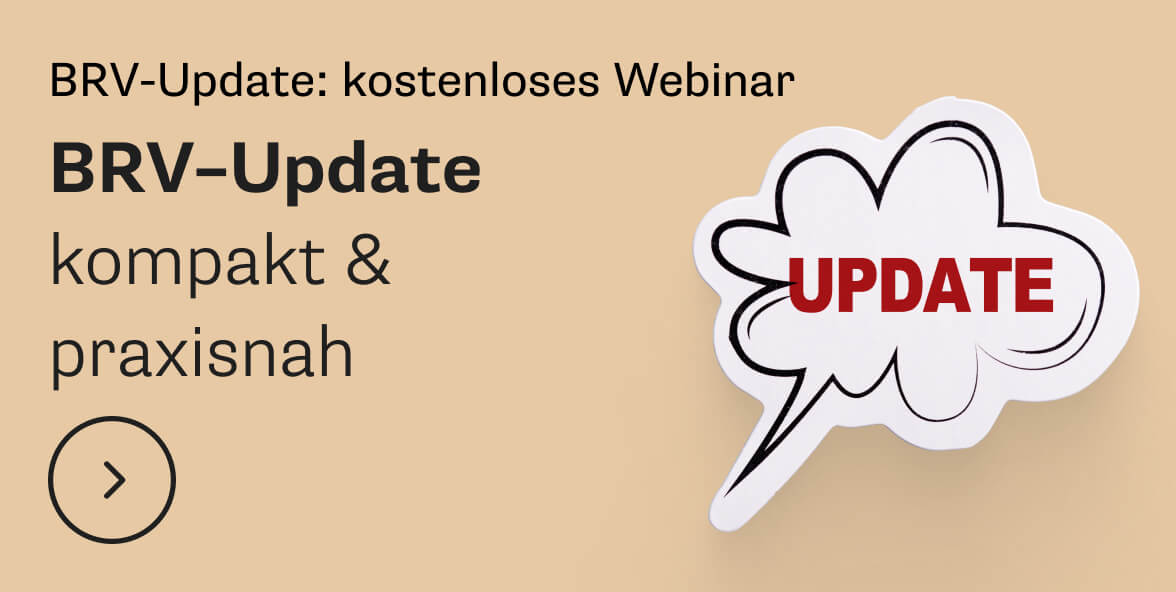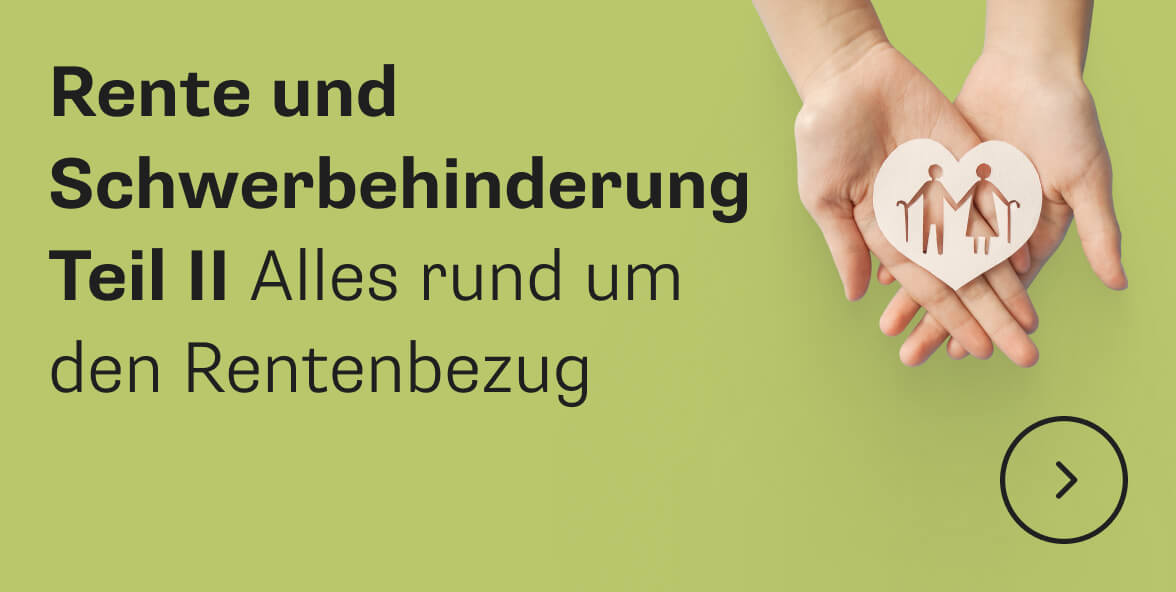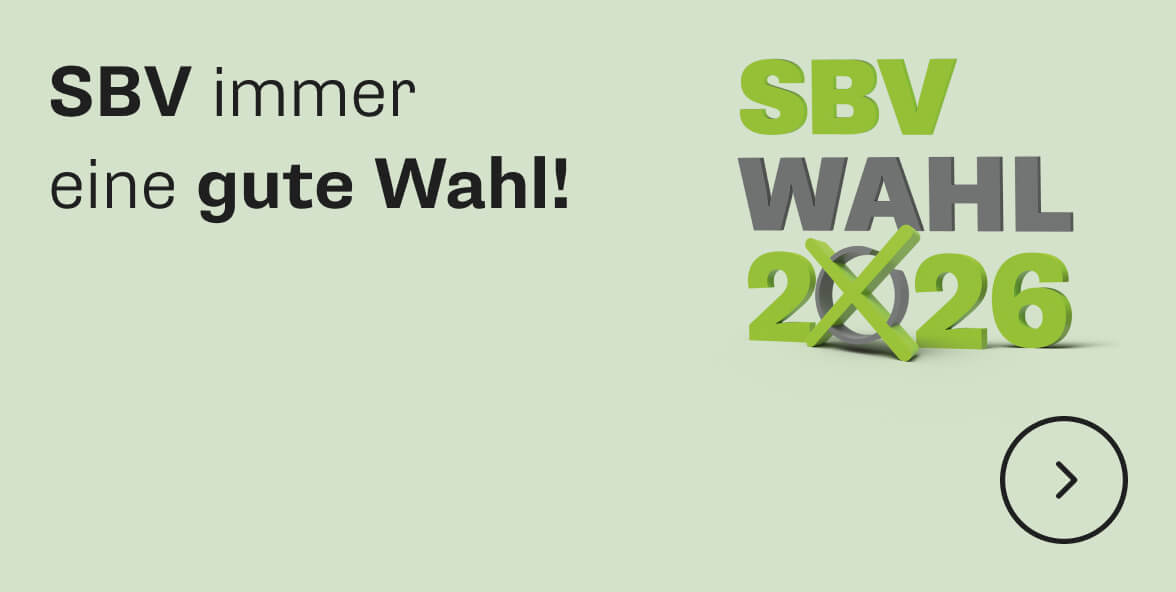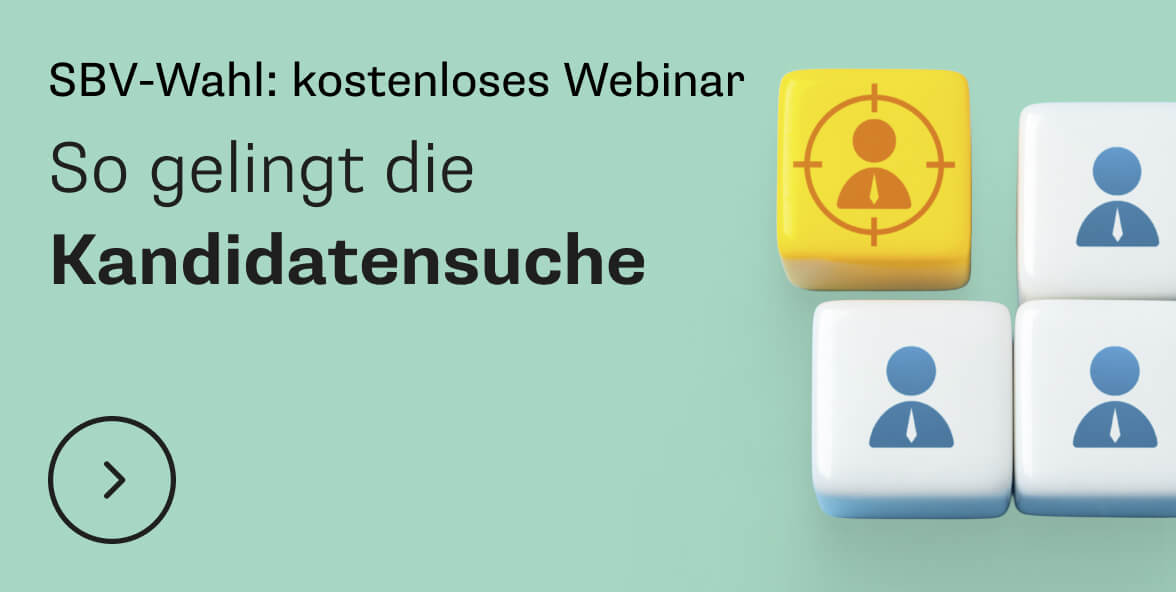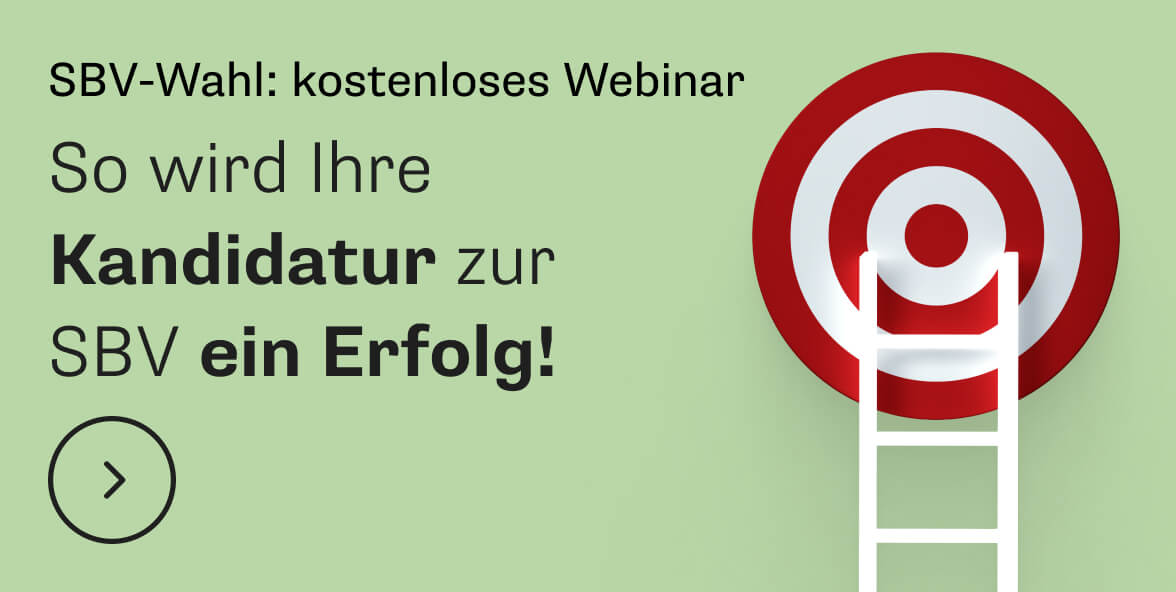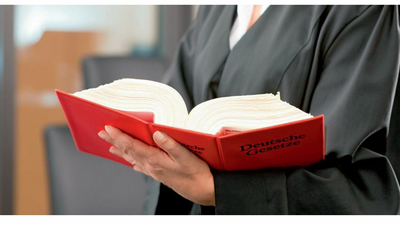Beschreibung
Errichtung
Der Betriebsrat wird in Betrieben mit mehr als fünf wahlberechtigten Arbeitnehmern, von denen mindestens drei wählbar sind, errichtet (§ 1 Abs. 1 BetrVG). Er wird in geheimer, unmittelbarer Wahl für eine Amtsperiode von vier Jahren gewählt (§ 14 Abs. 1 BetrVG). Wahlberechtigt sind alle Arbeitnehmer des Betriebs, die das 16. Lebensjahr vollendet haben (§ 7 BetrVG). Wählbar sind Wahlberechtigte, die am Wahltag das 18.Lebensjahr vollendet haben und sechs Monate dem Betrieb angehören (§ 8 Abs. 1 BetrVG). Die Zahl der Mitglieder des Betriebsrats ist nach der Größe des Betriebs gestaffelt und ungerade. Der Betriebsrat besteht in Betrieben mit in der Regel
- 5 bis 20 wahlberechtigten Arbeitnehmern aus einer Person
- 21 bis 50 wahlberechtigten Arbeitnehmern aus 3 Mitgliedern,
- 51 wahlberechtigten bis 100 Arbeitnehmern aus 5 Mitgliedern,
- 101 bis 200 Arbeitnehmern aus 7 Mitgliedern,
- 201 bis 400 Arbeitnehmern aus 9 Mitgliedern,
- 401 bis 700 Arbeitnehmern aus 11 Mitgliedern.
Die nächsten Schwellenwerte für die Erhöhung der Mitgliederzahl um jeweils zwei liegen bei 1.000, 1.500, 2.000 usw. (§ 9 BetrVG).
Verhältnis Arbeitgeber - Betriebsrat
Prinzip der Unabhängigkeit
Das Betriebsverfassungsgesetz und darauf beruhend die Bildung eines Betriebsrats übertragen den Demokratiegedanken der Verfassung der Bundesrepublik Deutschland in die Betriebe. Es handelt sich bei dem "Betriebsrat" um das Parlament des Betriebes. Demgemäß wird der Betriebsrat nach dem Inhalt des Betriebsverfassungsgesetzes dem Arbeitgeber als unabhängiges Organ gegenübergestellt. Es handelt sich dabei von der Konstruktion her um ein Gegenmachtmodell. Anders als der Aufsichtsrat ist der Betriebsrat nicht in die Führung des Betriebes eingebunden (vgl. § 77 Abs. 1 BetrVG). Er soll vielmehr die Leitungsbefugnisse des Arbeitgebers zum Schutz der Arbeitnehmer vor dessen sonst bestehender Übermacht begrenzen. Dazu hat der Betriebsrat allerdings - so heißt es in § 2 Betriebsverfassungsgesetz als "Grundgesetz des Betriebes" - mit dem Arbeitgeber vertrauensvoll zum Wohl der Arbeitnehmer und des Betriebes zusammenzuarbeiten.
Zur Sicherung der Unabhängigkeit der Betriebsratsmitglieder werden diese nach § 37 Abs. 2, 4, 5 BetrVG vor Entgeltverlust und Nachteilen in der beruflichen Entwicklung als Folge der Betriebsratstätigkeit bewahrt. Nach § 103 BetrVG bedarf deren allein in Betracht kommende außerordentliche Kündigung der Zustimmung des Betriebsrats. § 78 BetrVG verbietet jede Benachteiligung von Betriebsratsmitgliedern wegen ihrer Tätigkeit. Die Verletzung dieses Benachteiligungsverbotes wird dessen Bedeutung entsprechend als Straftatbestand gemäß § 119 Abs. 1 Nr. 3 BetrVG bewertet.
Zusammenarbeit mit dem Arbeitgeber
Im Verhältnis zwischen Arbeitgeber und den vom Betriebsrat vertretenen Arbeitnehmern ist grundsätzlich von Interessengegensätzen auszugehen. Der Arbeitgeber muss durch seine Tätigkeit einen Gewinn erzielen. Die Arbeitnehmer sind an einer angemessen hohen Vergütung interessiert. Dennoch gibt es gemeinsame Ziele und Interessenübereinstimmungen. Der Erhalt des Betriebes ist zum Beispiel ein Anliegen beider Seiten. Dessen Umsetzung dient das Gebot, zum Wohle der Arbeitnehmer und des Betriebs vertrauensvoll zusammenzuarbeiten (§ 2 Abs. 1 BetrVG). Dieses Gebot verpflichtet beide Seiten zur wechselseitigen Rücksichtnahme (§ 241 Abs. 2 BGB), Gesetzestreue, Ehrlichkeit und Offenheit im Umgang miteinander. Vertrauensvolle Zusammenarbeit ist die durchgängig anzuwendende Generalklausel für das Verhalten beider Betriebsparteien und deren Repräsentanten. Es ist unmittelbar geltendes Recht. Es wirkt direkt auf Inhalt und Abgrenzung aller aus dem Betriebsverfassungsgesetz sich ergebenden Rechte und Pflichten von Arbeitgeber und Betriebsrat ein (BAG v. 19.11.2019 -7 ABR 52/17 in NZA 2020, 727 Rn.30).
Arbeitgeber und Betriebsrat sollen mindestens einmal im Monat zu einer Besprechung (Monatsgespräch) zusammentreten, um über strittige Fragen mit dem ernsten Willen zur Einigung zu verhandeln und Vorschläge für die Beilegung von Meinungsverschiedenheiten zu machen (§ 74 Abs. 1 BetrVG). Interessengegensätze, für deren Ausgleich Arbeitgeber und Betriebsrat in Verhandlungen kein Einvernehmen erreichen können, werden im Fall von Rechtsstreitigkeiten durch das Arbeitsgericht und bei Regelungskonflikten durch die Einigungsstelle entschieden. "Rechtsstreitigkeiten" betreffen z.B. die Frage, "ob" dem Betriebsrat in einer bestimmten Angelegenheit ein Mitbestimmungsrecht zusteht. Um eine "Regelungsstreitigkeit" geht es bei der z. B. Frage der Verteilung der z.B. geschuldeten 40 Wochenstunden gleichmäßig auf jeden Wochentag oder ungleichmäßig mit unterschiedlicher Stundenzahl auf die einzelnen Wochentage, z. B. am Freitag nur 6 Stunden.
Aufgaben und Zuständigkeiten
Zuständigkeit
Zum Zwecke der Vertretung der kollektiven (gemeinsamen) Interessen der Arbeitnehmer nimmt der Betriebsrat eine Reihe von Aufgaben aus eigenem Recht und eigener Initiative wahr. Es handelt sich dabei z.B. um die dem Betriebsrat in § 80 BetrVG übertragenen Pflichten. Dazu gehört z.B. die Durchsetzung der tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und
Männern und die Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Darüber hinaus weist das Betriebsverfassungsgesetz dem Betriebsrat Aufgaben erst dann zu, wenn der Arbeitgeber dazu Veranlassung gibt, z.B. die Zustimmung zu einer Versetzung beantragt.
Nicht zuständig ist der Betriebsrat für individualrechtliche Ansprüche einzelner Arbeitnehmer, z.B. deren Lohnanspruch durchzusetzen. Einer deswegen dem Betriebsrat vorgetragenen Beschwerde muss der Betriebsrat jedoch im Falle ihrer gewissen Berechtigung nachgehen (§ 85 Abs. 1 BetrVG). Dasselbe gilt für die Bestimmung des Urlaubszeitpunktes eines einzelnen Arbeitnehmers. Der Betriebsrat hat hier gemäß § 87 Abs. 1 Nr. 5 BetrVG dessen Urlaubszeit mit dem Arbeitgeber festzulegen. Im Übrigen kann er nur in ausdrücklich im Gesetz genannten Faällenvon einzelnen Arbeitnehmern ermächtigt werden oder deren Interessen wahrnehmen z.B. §§ 82 ff BetrVG (ErfK/Koch, 25. Aufl. 2025, BetrVG § 1 Rn. 18).
Der Betriebsrat trifft seine Entscheidungen eigenverantwortlich und unabhängig. Er ist an Weisungen und die Zustimmung der Arbeitnehmerschaft nicht gebunden.
Allgemeine Aufgaben
Zu den allgemeinen Aufgaben des Betriebsrats gehört es, die Einhaltung der zugunsten der Arbeitnehmer geltenden arbeitsrechtlichen Normen zu überwachen (§ 80 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG). Die Palette der zu beachtenden Bestimmungen reicht von den Grundrechten des Grundgesetzes (GG) über sonstige Gesetze, EU-Richtlinien, Verordnungen und Tarifverträge bis zu den Betriebsvereinbarungen. Des Weiteren hat der Betriebsrat eine Reihe von Initiativrechten und Fördermaßnahmen für schutzbedürftige Arbeitnehmergruppen wahrzunehmen (§ 80 Abs. 1 Nr. 2 bis 9 BetrVG). Der Betriebsrat hat zusammen mit dem Arbeitgeber auch darüber zu wachen, dass alle im Betrieb tätigen Personen nach den Grundsätzen von Recht und Billigkeit behandelt werden, das heißt, insbesondere keine unberechtigten Benachteiligungen erleiden. Arbeitgeber und Betriebsrat haben die freie Entfaltung der Persönlichkeit der im Betrieb beschäftigten Arbeitnehmer zu schützen und zu fördern. Sie haben die Selbständigkeit und Eigeninitiative der Arbeitnehmer und Arbeitsgruppen zu fördern (§ 75 BetrVG).
Spezielle Aufgaben
Seine speziellen betriebsverfassungsrechtlichen Aufgaben verpflichten den Betriebsrat, auf Entscheidungen des Arbeitgebers in sozialen, personellen und wirtschaftlichen Angelegenheiten Einfluss zu nehmen, um die berechtigten Interessen der Arbeitnehmer zu wahren. Dazu stehen ihm die Instrumente der Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte vom Unterrichtungs-, Anhörungs- und Beratungs- sowie Widerspruchsrecht bis zur erzwingbaren Mitbestimmung zur Verfügung. Die Beteiligungsrechte des Betriebsrats werden ausgelöst bei anstehenden Entscheidungen des Arbeitgebers in
Erörterung von Rechtsfragen
Die Erörterung von Rechtsfragen der Arbeitnehmer mit dem Betriebsrat ist zulässig, soweit die Arbeitnehmer in ihrem Arbeitsverhältnis von den Rechtsfragen unmittelbar betroffen sind und das Anliegen im Zusammenhang mit den Betriebsratsaufgaben steht (§ 2 Abs. 3 Nr. 2 u. 3 Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG). Der erforderliche Zusammenhang mit den Aufgaben des Betriebsrats wird durch die Pflicht des Betriebsrats hergestellt, die Einhaltung der zu Gunsten der Arbeitnehmer geltenden Gesetze und Tarifverträge, Betriebsvereinbarungen usw. zu überwachen (§ 80 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG). So kann der Betriebsrat z. B. einem einzelnen Arbeitnehmer erläutern, ob diesem aufgrund einer Betriebsvereinbarung über eine Lohngruppenordnung ein Anspruch auf Höhergruppierung zusteht.
Vertretung
Der Betriebsratsvorsitzende (bei dessen Verhinderung, der stellvertretende Vorsitzende) vertritt den Betriebsrat im Rahmen der von diesem Gremium gefassten Beschlüsse. Er ist deshalb nicht Vertreter des Betriebsrats im Willen, sondern nur Vertreter in der Erklärung des gefassten Beschlusses (§ 26 Abs. 2 BetrVG). Gibt der Betriebsratsvorsitzende für den Betriebsrat eine Erklärung ab, so spricht eine (allerdings jederzeit widerlegbare) Vermutung dafür, dass der Betriebsrat einen entsprechenden Beschluss gefasst hat. Andernfalls kann der Betriebsrat die von dem Vorsitzenden abgegebene Erklärung rückwirkend genehmigen (BAG v. 8.2.2022 - 1 AZR 233/221 in NZA 2022, 984 Rn. 33).
Rechte und Pflichten
Prozessfähigkeit
Der Betriebsrat ist ein unabhängiges Organ der Betriebsverfassung und gleichberechtigter Betriebspartner des Arbeitgebers. Mit seiner Wahl wird der Betriebsrat Träger der im Betriebsverfassungsgesetz geregelten Rechte und Pflichten. Er ist von da an prozessfähig, das heißt, er kann Rechtstreitigkeiten gegen den Arbeitgeber führen, z.B. über die Frage des Bestehens von Mitbestimmungsrechten in bestimmten Angelegenheiten. Ebenso kann er den Umfang von Mitbestimmungsrechten in einem Feststellungsverfahren durch das Arbeitsgericht klären zu lassen (BAG v. 14.8.2001 - 1 ABR 52/00 in NZA 2002/109). Im arbeitsgerichtlichen Beschlussverfahren kann er Beteiligter und in der Zwangsvollstreckung Vollstreckungsschuldner und -gläubiger sein.
Rechts- und Vermögensfähigkeit
Der Betriebsrat besitzt nicht die Eigenschaft einer juristischen Person vergleichbar einer GmbH oder AG. Das Betriebsverfassungsgesetz verleiht ihm auch nicht dieselbe Rechtsstellung wie einer natürlichen Person (Mensch). Er besitzt deshalb keine Rechtspersönlichkeit und damit auch keine generelle (volle) Rechts- und Vermögensfähigkeit. Er ist auch nicht Vertreter der Belegschaft. Er handelt vielmehr immer im eigenen Namen und das weisungsfrei. Aus den vorstehenden Gründen kann er als solcher nicht am allgemeinen Rechtsverkehr teilnehmen.
Gleichwohl ist er innerhalb des ihm gesetzlich übertragenen Wirkungskreises teilrechts- und teilvermögensfähig (Richardi, BetrVG, 17. Aufl. 2022, § 40 Rn. 84). Er kann innerhalb der Betriebsverfassung als Träger von Rechten und Pflichten behandelt werden (Münchner Handbuch Arbeitsrecht/Boehmke, 6. Aufl. 2025, § 286 Rn. 16). Die partielle (teilweise) Vermögensfähigkeit besteht insoweit, als das Betriebsverfassungsgesetz rechtliche Ansprüche zur Erstattung von erforderlichen Kosten der Betriebsratsarbeit und zur Deckung des Sachaufwands im erforderlichen Umfang vorsieht. Dies sind im Wesentlichen die Existenz und die Arbeitsfähigkeit des Betriebsrats sichernde Ansprüche nach § 40 Abs. 1 und 2 BetrVG (Kosten und Sachaufwand des Betriebsrats).
Auf der Rechtsgrundlage des § 40 BetrVG kann der Betriebsrat im eigenen Namen mit Dritten wirksame Verträge schließen, z. B. einen Rechtsanwalt mit seiner Vertretung beauftragen. Aufgrund der Kostentragungspflicht des Arbeitgebers entsteht zwischen dem Arbeitgeber und dem Betriebsrat ein gesetzliches Schuldverhältnis. Dieses führt zu einem vermögensrechtlichen Anspruch des Betriebsrats gegen den Arbeitgeber auf Kostenerstattung, z.B. für den Kauf eines Fachbuches. An diesem erwirbt der Betriebsrat ein dauerhaftes Besitzrecht. Trotz bestehender Teilrechtsvermögensfähigkeit wird er jedoch mangels eigener Rechtspersönlichkeit nicht dessen Eigentümer. Er bleibt nur dauerhafter Besitzer (siehe dazu Fitting, BetrVG, 32. Aufl. 2024, §1 Rn. 304). Eigentümer wird der Arbeitgeber (ErfK/Koch, 25. Aufl. 2025, BetrVG § 1 Rn. 18). In dieser Einschränkung liegt keine Behinderung der Betriebsratsarbeit. Denn der Besitz genügt für die Nutzung z.B. eines Buches. Bezüglich der in einem Seminar ausgegebenen Unterlagen kann das Betriebsratsmitglied, nicht aber der Betriebsrat, Eigentum erwerben.
Auf der Basis des § 40 oder des § 111 Satz 2 BetrVG kann der Betriebsrat auch die Beauftragung eines Rechtsanwalts beschließen und durchführen. Der dem Betriebsrat als solchem zustehende Anspruch aus § 40 BetrVG zielt dann auf eine Freistellung von Verbindlichkeiten z.B. aus der Beauftragung eines Rechtsanwaltes. Denn der Arbeitgeber hat die Kosten zu tragen, die dem Betriebsrat zur Wahrnehmung seiner Aufgaben entstanden sind (§ 40 Abs. 1 BetrVG).
Tritt der Betriebsrat den Freistellungsanspruch gegen den Arbeitgeber an den Rechtsanwalt als sogenanntem Gläubiger ab, verwandelt sich dieser in einen Zahlungsanspruch des Rechtsanwaltes gegen den Arbeitgeber (BAG v. 18.11.2020 - 7 ABR37/19 in NZA 2021, 657 Rn. 20).
Vermögensrechtliche Ansprüche des Betriebsrats gegen den Arbeitgeber entstehen jedoch nur, soweit
- die vereinbarte Leistung zur Erfüllung der Aufgaben des Betriebsrats erforderlich ist (§ 40 Abs.1 BetrVG),
- das versprochene Entgelt marktüblich ist (z. B. auf der Grundlage des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes (RVG) und
- der vereinbarten Leistung ein ordnungsgemäß gefasster Beschluss des Betriebsrats (§ 33 BetrVG) zu Grunde liegt.
Bei der Prüfung der Erforderlichkeit steht dem Betriebsrat ein Ermessensspielraum zu. Dessen Grenze ist im Interesse der Funktions- und Handlungsfähigkeit des Betriebsrats nicht zu eng zu ziehen (BGH v. 25.10.2012 - III ZR 266/11 in NZA 2012,1382).
Haftung
Ist eine dieser Voraussetzungen nicht erfüllt, ist der Vertrag des Betriebsrats mit einem Dritten unwirksam. Dies hat zur Folge, dass der Betriebsrat für die daraus resultierenden Verbindlichkeiten einzustehen hat. Da aber das betriebsverfassungsrechtliche Organ Betriebsrat keine Rechtspersönlichkeit ist, kann es für Kosten, die dem Vertragspartner durch eine (teil-)unwirksame Vereinbarung entstanden sind, nicht in Anspruch genommen werden (Fitting, BetrVG, 32. Aufl. 2024, § 1 Rn.306).
Als Anspruchsgegner für den Vertragspartner kommt das den Vertrag abschließende Betriebsratsmitglied in Betracht. Das dürfte in der Regel der Betriebsratsvorsitzende sein.
Das vertragschließende Betriebsratsmitglied haftet, weil es seine Vertretungsmacht insoweit überschreitet, wie die getroffene Vereinbarung nicht durch den Kostenerstattungs- und Freistellungsanspruch gegen den Arbeitgeber gedeckt ist (§ 179 Abs. 1 BGB, BGH v. 25.10.2012 - III ZR 266/11 in NZA 2012,1382). Hat das vertragschließende Betriebsratsmitglied den Mangel seiner Vertretungsmacht nicht gekannt, haftet es nur für den so genannten „Vertrauensschaden“ (negatives Interesse des Gläubigers). Das ist der Schaden, welchen der Berater dadurch erleidet, dass er auf die Vertretungsmacht vertraut hat (§ 179 Abs.2 BGB). Die Haftung des handelnden Betriebsratsmitglieds ist ausgeschlossen, wenn dem Berater bekannt oder in Folge von Fahrlässigkeit unbekannt war, dass der Vertragsschluss einen außerhalb des gesetzlichen Wirkungskreises des Betriebsrats liegenden Gegenstand betraf oder das durch den Vertrag ausgelöste Honorar (teilweise) nicht nach § 40 Abs. 1 BetrVG erstattungsfähig ist, etwa weil die vereinbarte Honorarhöhe nicht den marktüblichen Sätzen entspricht oder die vereinbarten Leistungen über das erforderliche Maß hinausgehen (§ 179 Abs. 3 BGB, BGH v. 25.10.2012 - III ZR 266/11in NZA 2012,1382). Eine Haftung des Betriebsrats aus unerlaubter Handlung, wegen eines Verstoßes gegen ein Schutzgesetz oder wegen sittenwidriger vorsätzliche Schädigung einer Person scheidet aus (§§ 823 Abs. 1 u. 2, 826 BGB). Wegen weiterer Einzelheiten kann verwiesen werden auf Fitting, BetrVG, 32. Aufl. 2024, § 1 Rn. 309).
Umlageverbot
Die Erhebung von Beiträgen der Arbeitnehmer für Zwecke des Betriebsrats ist unzulässig (§ 41 BetrVG). Das Umlageverbot gegenüber den Arbeitnehmern gilt aus Gründen der Wahrung der Unabhängigkeit des Betriebsrats gleichermaßen für Zuwendungen von Seiten der Gewerkschaften oder des Arbeitgebers. Es gehört auch nicht zu den betriebsverfassungsrechtlichen Aufgaben des Betriebsrats, Kassen zu führen oder Gelder zu verwalten (z.B. „Freud- und Leidkasse des Betriebs“, Einnahmen aus Getränkeautomaten usw.).
Verbot parteipolitischer Betätigung
Arbeitgeber und Betriebsrat haben jede parteipolitische Betätigung im Betrieb zu unterlassen (§ 74 Abs. 2 S. 3 BetrVG). Es muss sich nicht nur um das Eintreten für eine Partei im Sinne von Art. 21 GG und des Parteiengesetzes handeln. Es kann auch eine politische Gruppierung sein, für die geworben oder die unterstützt wird. Von dem Verbot ist mithin auch das Eintreten für oder gegen eine bestimmte politische Richtung erfasst (BAG v. 12.6.1986 - 6 ABR 67/84). Dagegen fallen Äußerungen allgemeinpolitischer Art, die eine politische Partei, Gruppierung oder Richtung weder unterstützen noch sich gegen sie wenden (z. B. Aufruf des Betriebsrats an die Belegschaft, sich einem Krieg zu widersetzen), nicht unter das Verbot. Verstößt der Betriebsrat gegen das parteipolitische Neutralitätsgebot, begründet dies keinen Unterlassungsanspruch des Arbeitgebers. Er wäre wegen der Vermögenslosigkeit des Betriebsrats auch nicht vollstreckbar. Grobe Verstöße des Betriebsrats gegen seine Pflicht zur parteipolitischen Neutralität berechtigen vielmehr den Arbeitgeber, beim Arbeitsgericht die Auflösung des Betriebsrats zu beantragen (§ 23 Abs. 1 Satz 1 BetrVG, Ausschluss aus dem Betriebsrat – Auflösung des Betriebsrats). Streitigkeiten über die Zulässigkeit einer bestimmten Betätigung des Betriebsrats kann der Arbeitgeber im Wege eines Feststellungsantrags klären lassen. Eine entsprechende gerichtliche Feststellung ist im Falle einer späteren Pflichtverletzung des Betriebsrats von entscheidender Bedeutung für einen Auflösungsantrag des Arbeitgebers. Voraussetzung für einen Feststellungsantrag ist allerdings, dass der Arbeitgeber zum Zeitpunkt der begehrten gerichtlichen Entscheidung noch ein berechtigtes Interesse an der Klärung der Streitfrage hat (BAG v. 17.3.2010 - 7 ABR 95/08 in NZA 2010, 1133).
Amtszeit
Regelmäßige Amtszeit
Die regelmäßige Amtszeit des Betriebsrats beträgt vier Jahre (§ 21 BetrVG). Regelmäßige Betriebsratswahlen finden daher alle vier Jahre (z.B. 2022, 2026) in der Zeit vom 1. März bis 31. Mai statt (§ 13 Abs. 1 BetrVG). Bei einer regelmäßigen Wahl beginnt die Amtszeit des neuen Betriebsrats am Tag nach Ablauf der Amtszeit des bisherigen Betriebsrats (§ 21 BetrVG), sofern zu diesem Zeitpunkt das Wahlergebnis des neugewählten Betriebsrats bereits bekannt gemacht wurde. Sie endet nach vier Jahren mit Ablauf des Vortages, an dem sie kalendermäßig seinerzeit begonnen hat, weil in diesem Falle der Beginn des Tages der für die Amtsübernahme maßgebende Zeitpunkt für die Fristberechnung ist (§ 187 Abs. 2 BGB). So endet beispielsweise die regelmäßige Amtszeit eines Betriebsrats, der am 15.4.2022 sein Amt übernommen hat, mit Ablauf des 14.4.2026, 24 Uhr. Der neugewählte Betriebsrat ist ab dem 15.4.2026, 0 Uhr im Amt. Ist mit Ablauf der Amtszeit das Wahlergebnis noch nicht bekannt gegeben, folgt eine betriebsratslose Zeit, die mit der Bekanntgabe des Wahlergebnisses endet.
Vorzeitige Beendigung nach Neuwahl
Die Amtszeit des Betriebsrats endet außerhalb des regelmäßigen Wahlzeitraums vorzeitig nach Neuwahl mit der Bekanntgabe des Wahlergebnisses, spätestens jedoch am 31. Mai des folgenden regelmäßigen Wahljahres, wenn
- mit Ablauf von 24 Monaten seit dem Tag der letzten Wahl die Zahl der regelmäßig beschäftigten Arbeitnehmer um die Hälfte, mindestens aber um 50 gestiegen oder gesunken ist (§ 13 Abs. 2 Nr. 1 BetrVG),
- die gesetzlich vorgeschriebene Zahl der Betriebsratsmitglieder nach Ausscheiden von ordentlichen Mitgliedern trotz Nachrückens sämtlicher Ersatzmitglieder unterschritten wurde (§ 13 Abs. 2 Nr. 2 BetrVG),
- der Betriebsrat mit der Mehrheit der Stimmen seiner Mitglieder (absolute Mehrheit) seinen Rücktritt beschlossen hat (§ 13 Abs. 2 Nr. 3 BetrVG).
In diesen Fällen bleibt der Betriebsrat bis zur Bekanntgabe des Wahlergebnisses, spätestens jedoch bis zum 31. Mai des folgenden regelmäßigen Wahljahres geschäftsführend im Amt. Dies gilt auch dann, wenn alle Mitglieder gleichzeitig einzeln ihre Ämter niederlegen. Dieses Verhalten ist als kollektiver Rücktritt auszulegen (so Fitting, BetrVG, 32. Aufl. 2022, § 13 Rn.41). Anders als bei einer Amtsniederlegung (BAG v. 30.6.2021 - 7 ABR 24/20 in NZA 2021,1561 Rn. 21) entsteht bei dieser Auslegung keine betriebsratslose Zeit. Der bisherige Betriebsrat bleibt vielmehr bis zur Bekanntgabe des Wahlergebnisses eines neu zu wählenden Betriebsrats im Amt. Er hat die Betriebsratsarbeit wie bisher fortzuführen (Fitting BetrVG, 32. Aufl. 2022, § 21 Rn. 27).
Der Betriebsrat hat unverzüglich nach Bekanntwerden des Tatbestandes, der die Neuwahl erfordert, den Wahlvorstand zur Einleitung der Neuwahl zu bestellen (§ 16 Abs. 1 BetrVG). Gleichzeitig mit Bekanntgabe des Wahlergebnisses des neugewählten Betriebsrats beginnt dann dessen Amtszeit. Dies gilt auch für den Fall, dass zu diesem Zeitpunkt kein Betriebsrat besteht, weil z. B. erstmals ein Betriebsrat gewählt wurde oder die reguläre Amtszeit des Vorgänger-Betriebsrats vorher abgelaufen ist. Bekannt gemacht ist das Wahlergebnis an dem Tag, an dem es vom Wahlvorstand im Betrieb ausgehängt wird (§ 19 WahlO). Wird das Ergebnis der Betriebsratswahl nicht förmlich bekanntgegeben, endet die Amtszeit des geschäftsführenden Betriebsrats spätestens mit der konstituierenden Sitzung des neu gewählten Gremiums. auch wenn zu diesem Zeitpunkt die reguläre Amtszeit noch nicht abgelaufen ist (BAG v. 5.11.2009 - 2 AZR 487/08 in NZA-RR 2010,236 Rn.13).
Beendigung mit sofortiger Wirkung oder durch Gerichtsentscheidung
Mit sofortiger Wirkung bzw. nach Rechtskraft der arbeitsgerichtlichen Entscheidung endet die Amtszeit eines Betriebsrats, wenn
- alle Mitglieder und Ersatzmitglieder aus ihren Ämtern ausgeschieden sind,
- die Wahl des Betriebsrats mit Erfolg angefochten (§ 13 Abs. 2 Nr. 4 i. V. m. § 19 BetrVG) oder
- auf Antrag von einem Viertel der wahlberechtigten Arbeitnehmer, des Arbeitgebers oder einer im Betrieb vertretenen Gewerkschaft der Betriebsrat durch arbeitsgerichtliche Entscheidung wegen grober Verletzung seiner Pflichten rechtskräftig aufgelöst wurde (§ 13 Abs. 2 Nr. 5 i. V. m. § 23 Abs. 1 BetrVG).
In diesen Fällen ist der Betrieb ab diesem Zeitpunkt betriebsratslos. Im Falle der Auflösung des Betriebsrats durch das Arbeitsgericht wegen grober Pflichtverletzung (§ 13 Abs. 2 Nr. 5 BetrVG) bestellt das Arbeitsgericht den Wahlvorstand (§ 23 Abs. 2 BetrVG).
Verlängerte Amtszeit
Ausnahmsweise kann sich bei einer Wahl außerhalb des regelmäßigen Wahlzeitraums die Amtszeit des Betriebsrats über vier Jahre hinaus verlängern, wenn der außerplanmäßig gewählte Betriebsrat am 1. März des nächsten Wahljahres weniger als ein Jahr im Amt ist. In diesem Falle findet die nächste Betriebsratswahl erst im übernächsten Wahljahr statt und die Amtszeit endet mit der Bekanntgabe des Wahlergebnisses, spätestens am 31. Mai des übernächsten regelmäßigen Wahljahres. So endet beispielsweise die Amtszeit eines Betriebsrats, dessen Wahlergebnis der außerplanmäßigen Wahl am 10.3.2025 bekannt gegeben wurde, mit Bekanntgabe des Ergebnisses der in der regulären Wahlperiode 2030 fälligen erneuten Wahl, spätestens jedoch mit Ablauf des 31.5.2030.
Restmandat
Geht ein Betrieb durch Stilllegung, Spaltung oder Zusammenlegung unter, so bleibt dessen Betriebsrat so lange im Amt, wie dies zur Wahrnehmung der damit im Zusammenhang stehenden Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte erforderlich ist (§ 21b BetrVG). Das Restmandat sichert dem Betriebsrat das Recht, seine Aufgaben (z. B. die Beteiligungsrechte in Folge einer Betriebsänderung (§ 111 ff BetrVG) zum Schutze der betroffenen Arbeitnehmer auch über das Ende seiner Amtszeit hinaus wahrzunehmen. Das Restmandat entsteht mit dem Wegfall der betrieblichen Organisation und ist von dem Betriebsrat auszuüben, der bei Beendigung des Vollmandats im Amt war. Die Betriebsratsmitglieder im Restmandat führen die Geschäfte weiter (§§ 22, 13 Abs. 2 Nr. 2 BetrVG), solange im Zusammenhang mit der Betriebsstilllegung oder Zusammenlegung noch Verhandlungsgegenstände offen sind (BAG v. 6.12.2006 – 7 ABR 62/05). Die Mitgliedschaft im restmandatierten Betriebsrat endet nicht durch die Beendigung des Arbeitsverhältnisses (BAG v. 5.5.2010 - 7 AZR 728/08).
Übergangsmandat
Wird ein Betrieb gespalten, so bleibt dessen Betriebsrat im Amt und führt die Geschäfte für die ihm bislang zugeordneten Betriebsteile im Übergangsmandat weiter, soweit diese
- aus mindestens fünf ständigen wahlberechtigten Arbeitnehmern, von denen drei wählbar sind, bestehen (§ 1 Abs. 1 Satz 1 BetrVG) und
- nicht in einen Betrieb eingegliedert werden, in dem ein Betriebsrat besteht (§ 21a Abs. 1 BetrVG).
Werden Betriebe oder Betriebsteile zu einem Betrieb verschmolzen, so nimmt der Betriebsrat des nach der Zahl der wahlberechtigten Arbeitnehmer größten Betriebs oder Betriebsteils das Übergangsmandat wahr (§ 21a Abs. 2 BetrVG). Der mit dem Übergangsmandat betraute Betriebsrat hat insbesondere unverzüglich einen Wahlvorstand zu bestellen. Das Übergangs-mandat endet, sobald ein neuer Betriebsrat gewählt und das Wahlergebnis bekannt gegeben ist, spätestens jedoch sechs Monate nach Wirksamwerden der Spaltung oder des Zusammenschlusses. Durch Tarifvertrag oder Betriebsvereinbarung kann das Übergangsmandat um weitere sechs Monate verlängert werden (§ 21a Abs. 1, 2 u. 3 BetrVG).
Andere betriebsverfassungsrechtliche Vertretungsorgane
In Unternehmen mit mehreren Betrieben kann durch Tarifvertrag ein unternehmenseinheitlicher Betriebsrat gebildet werden, wenn dies die Bildung von Betriebsräten erleichtert oder einer sachgerechten Wahrnehmung der Interessen der Arbeitnehmer dient (§ 3 Abs. 1 Nr. 1a BetrVG). Damit wird vor allem für kleinere Betriebe die Möglichkeit verbessert, einen Betriebsrat zu wählen. Besteht keine tarifliche Regelung und gilt auch kein anderer Tarifvertrag, kann die Regelung durch Betriebsvereinbarung getroffen werden (§ 3 Abs. 2 BetrVG). Unter denselben Voraussetzungen können mehrere Betriebe oder Betriebsteile zusammengefasst werden, um einen gemeinsamen Betriebsrat zu bilden (§ 3 Abs. 1 Nr. 1 b BetrVG). Die zusammengefassten Betriebe gelten betriebserfassungsrechtlich als ein Betrieb (§ 1 Abs. 1 BetrVG). Ebenfalls durch Tarifvertrag kann in Unternehmen und Konzernen, die nach produkt- oder projektbezogenen Geschäftsbereichen (Sparten) organisiert sind, ein Spartenbetriebsrat gebildet werden. Die Errichtung dieser Organisationsform zur Vertretung der Arbeitnehmerinteressen muss der sachgerechten Wahrnehmung der Aufgaben des Betriebsrats dienlich sein und die Leitung der Sparte muss befugt sein, auch Entscheidungen in beteiligungspflichtigen Angelegenheiten zu treffen (§ 3 Abs. 1 Nr. 2 BetrVG). Auch in diesem Fall kann die Regelung durch Betriebsvereinbarung getroffen werden, wenn keine tarifliche Regelung besteht und auch kein anderer Tarifvertrag gilt (§ 3 Abs. 2 BetrVG).
Eine über den gesetzlichen Rahmen hinausgehende generelle Vermögensfähigkeit kann auch durch Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat nicht geschaffen werden. Daher ist der Betriebsrat rechtlich nicht berechtigt, mit dem Arbeitgeber eine im Falle der Verletzung von Mitbestimmungsrechten unmittelbar an ihn zu zahlende Vertragsstrafe zu vereinbaren (BAG v. 29.9.2004 – 1 ABR 30/03).