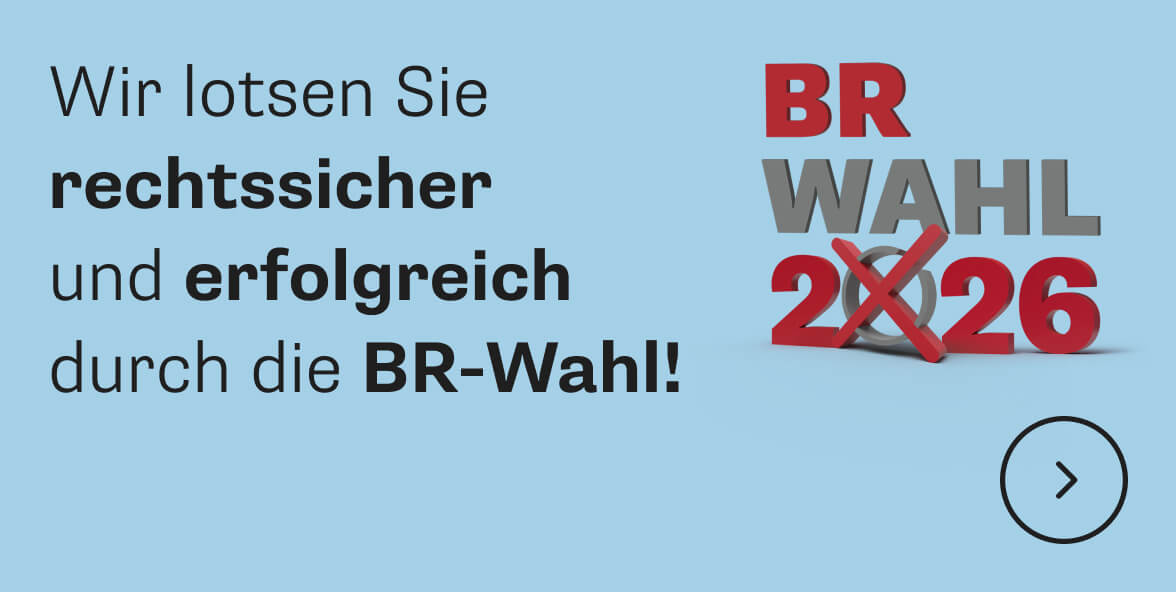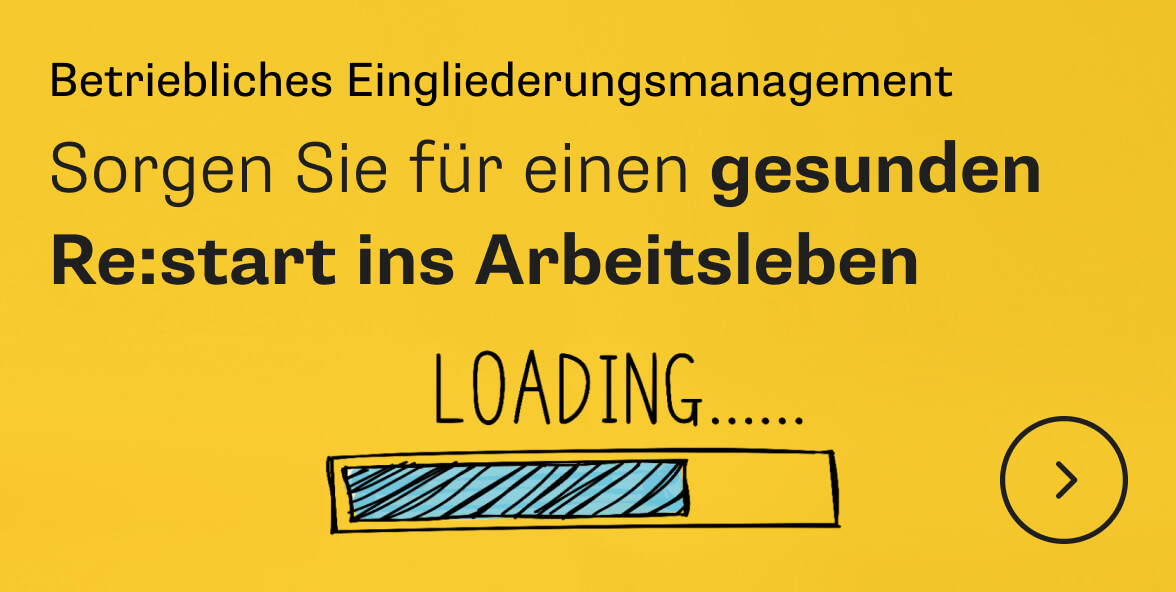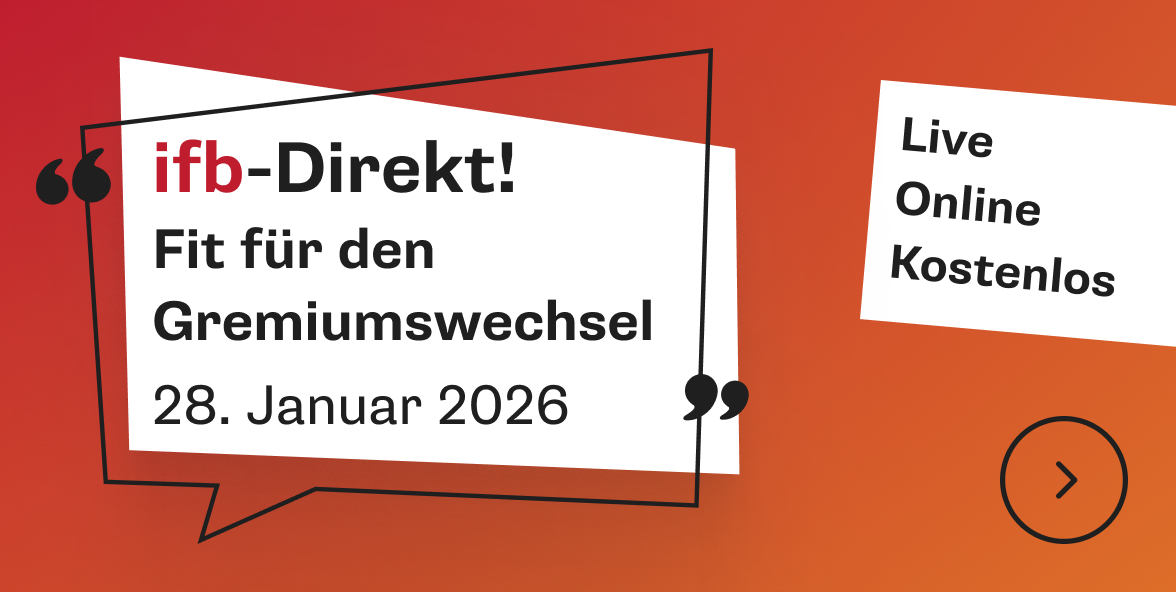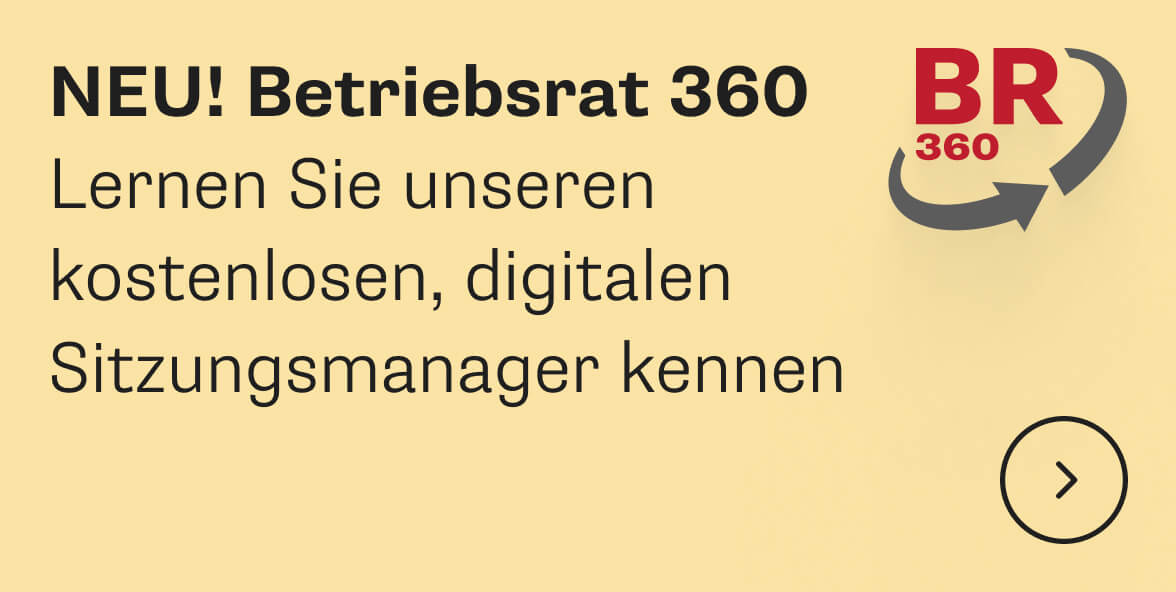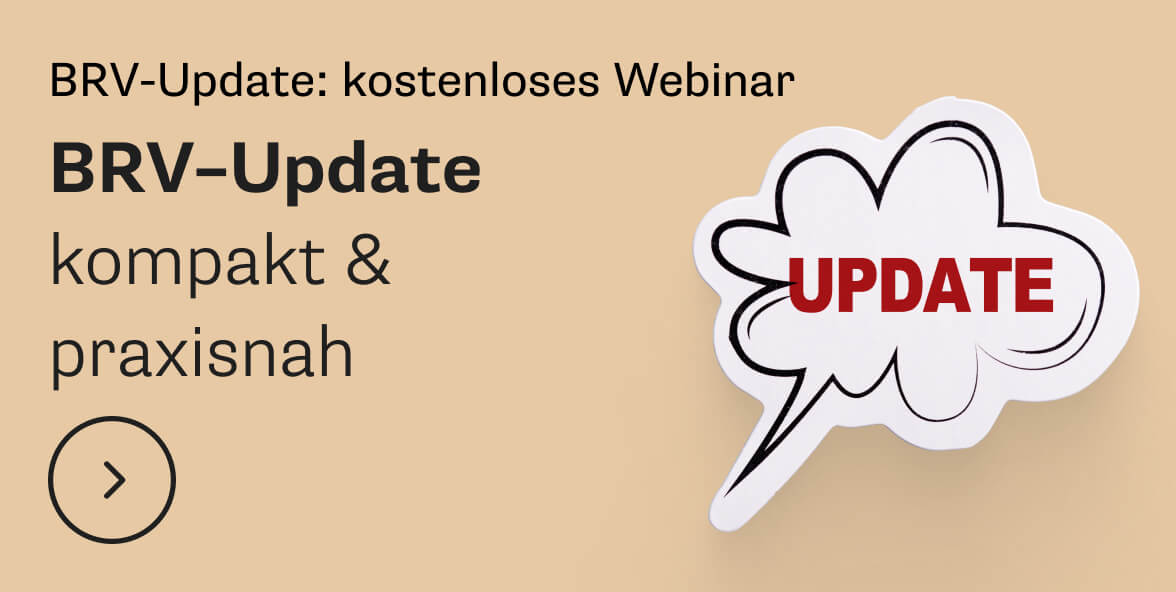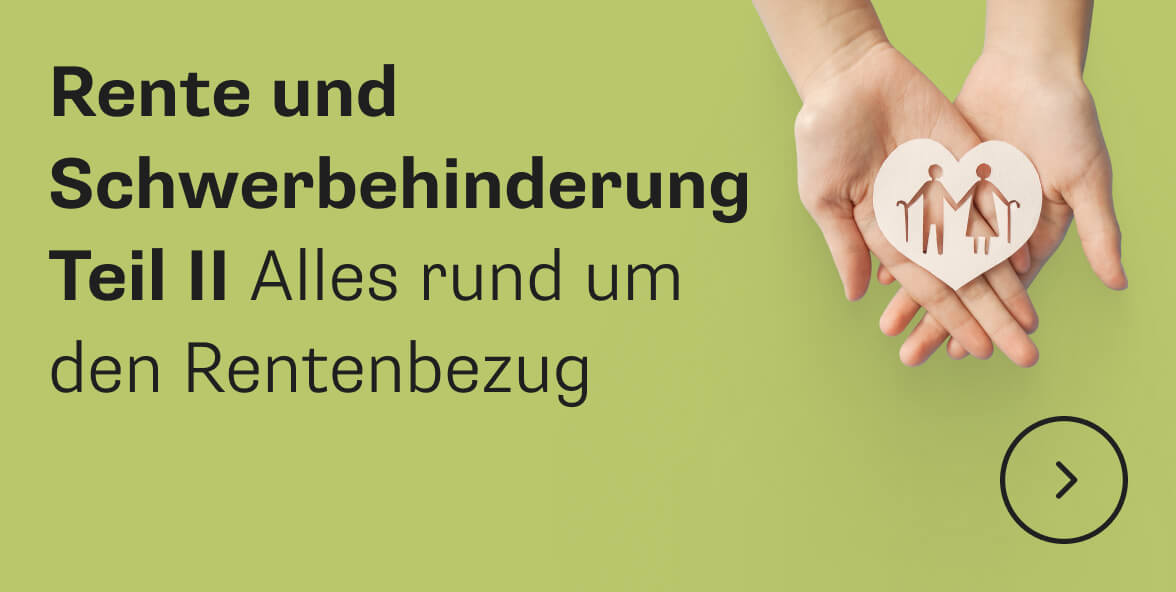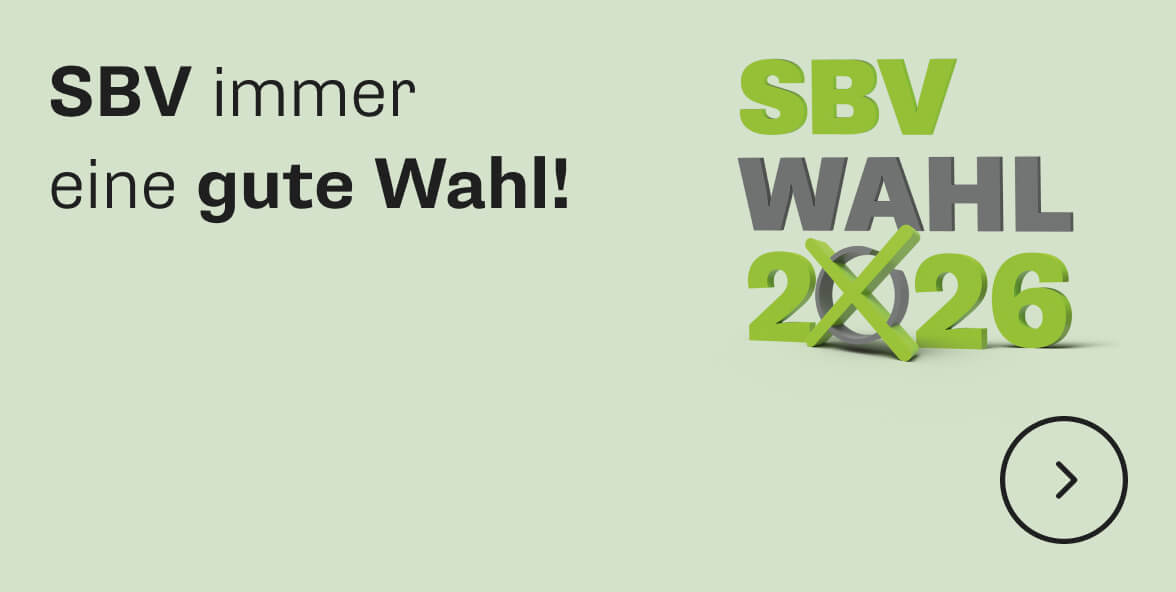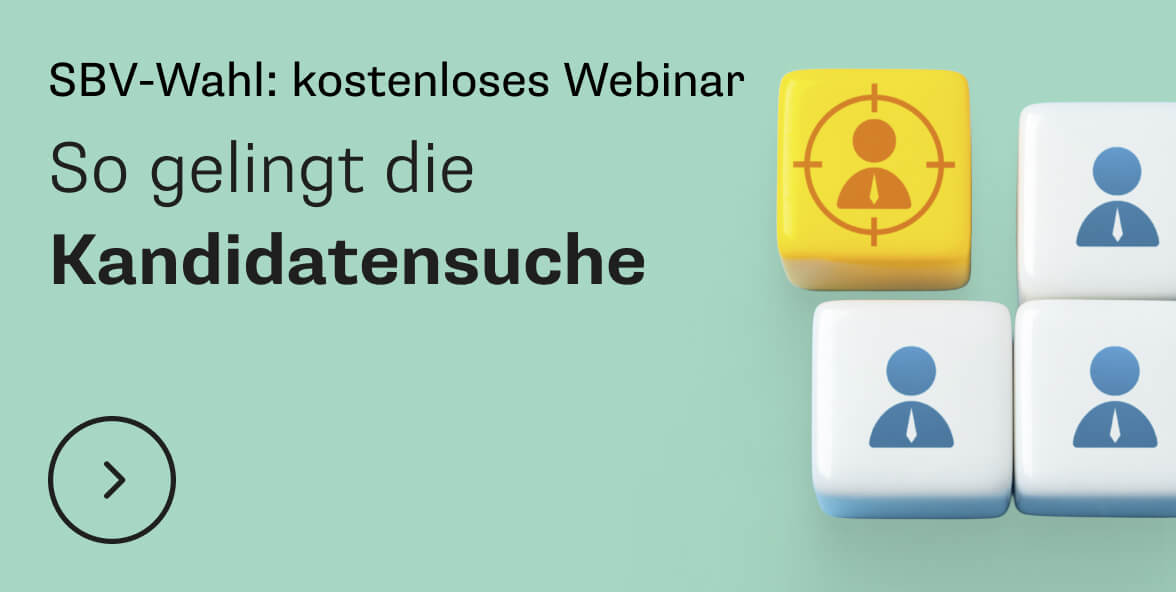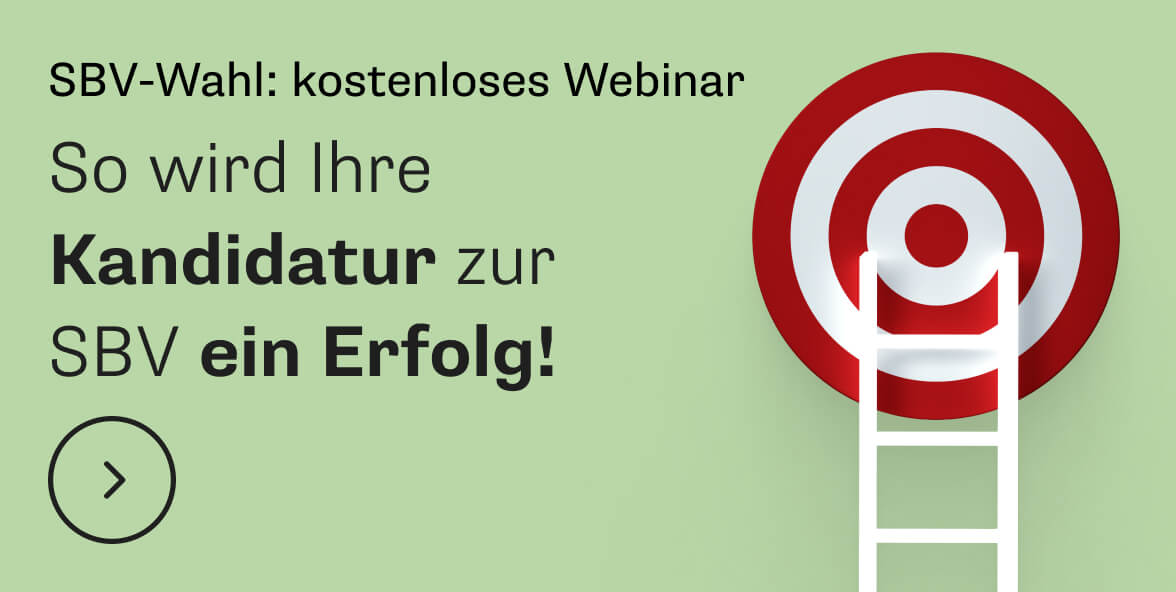Erläuterung
Allgemeines
Arbeitnehmer leben in der Regel von ihrem Arbeitsentgelt. Dieses fällt mit Eintritt in den Ruhestand weg. Deshalb besteht ein dringender Bedarf für deren Einkommensabsicherung im Alter. Dieses Ziel soll durch eine auf drei Säulen basierende Altersvorsorge erreicht werden. Die erste Säule bildet die gesetzliche Rentenversicherung. Sie deckt die biologischen Risiken der Langlebigkeit, des Todes und der Invalidität ab.
Die zweite Säule besteht in einer betrieblichen Altersversorgung. Dabei handelt es sich um eine rein freiwillige Leistung eines Arbeitgebers an die bisherigen Mitarbeiter ab Eintritt des Versorgungsfalles. Es handelt sich um eine "nachgelagerte" Entgeltzahlung mit Fürsorgecharakter (Fitting, BetrVG, 32. Aufl. 2024, § 87 Rn. 468). Um den Beitrag der zweiten Säule zu stärken, ist die betriebliche Altersversorgung durch Gewährung steuerlicher Anreize und ein Sozialpartnermodell durch das "Betriebsrentenstärkungsgesetz - BetrAVG " vom 22.12.2022 verbessert worden.
Darin werden die Tarifvertragsparteien ermächtigt, reine beitragsbezogene Versorgungsmodelle einzuführen. Diese verpflichten den Arbeitgeber lediglich zur Zahlung bestimmter Beiträge an eine Lebensversicherung, Pensionskasse oder Pensionsfonds. Der Arbeitgeber garantiert in diesem Fall den Betriebsrentnern keine Mindestrentenleistung. Er schuldet nur Auskunft über den Stand des Altersvorsorgekontos und die zu erwartende Leistung.
Die dritte Säule bildet die private Altersvorsorge der Mitarbeiter.
Gesetzliche Grundlagen
Die betriebliche Altersversorgung ist im Gesetz zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung (BetrAVG) geregelt. Dieses Gesetz wird gemäß seiner offiziellen "Überschrift" auch "Betriebsrentengesetz - BetrAVG" genannt.
Voraussetzung für das Vorliegen einer vom BetrAVG erfassten betrieblichen Altersversorgung ist, dass diese
a) einen Zusammenhang mit einem betrieblichen Arbeitsverhältnis aufweist und
b) die Leistungspflicht durch eines der biologischen Ereignisse Alter, Invalidität oder Tod ausgelöst wird und
c) die Zusage dem Versorgungszweck dient.
Fehlen diese Voraussetzungen, entfällt für solche Leistungen der durch das BetrAVG andernfalls gewährte Schutz z.B. in Form der Sicherung von Anwartschaften und der Schutz im Falle von Insolvenz des Arbeitgebers.
Im Einzelfall kann es schwierig sein, zwischen Leistungen zum Ausgleich des biologisch bedingten Wegfalles des Arbeitsplatzes oder auf sonstigen Fürsorgeerwägungen beruhenden Zahlungen wie z.B. einem Treuegeld, Beihilfen an Rentner zur Beseitigung erlittener Elementarschäden usw. zu unterscheiden. Freiwillig gezahlte Beiträge zu einer Krankenversicherung oder Abfindungen für den Verlust des Arbeitsplatzes fallen z.B. nicht unter die Schutzbestimmungen des betrieblichen Altersversorgungsgesetzes. Die Zahlung eines Weihnachtsgeldes an Betriebsrentner kann hingegen Teil der betrieblichen Altersversorgung sein (BAG v. 31.7.2007 -3 AZR 189/06 in NZA-RR 2008,263).
Das Bundesarbeitsgericht geht bei der Prüfung der Gültigkeit einzelner Bestimmungen von Versorgungszusagen von einem "Mischcharakter" der Versorgungsleistung aus (siehe BAG v. 12.2.2013 - 3 AZR 100/11 in NZA 2013, 733 Rn.32). Es beurteilt die Gültigkeit der Kriterien für die Abgrenzung des Teilnehmerkreises deshalb unter Fürsorge- und Entgeltgesichtspunkten. Das gilt z.B. für die Gültigkeit der zeitlichen Länge anspruchsausschließender Mindestwartezeiten. Sind diese zu lang, sind sie wegen fehlender Berücksichtigung der gezeigten Betriebstreue (Entgeltaspekt) unwirksam. Versorgungsleistungen ohne Wartezeit sprechen für deren Fürsorgecharakter. Deren Bindung an die Dauer der Betriebszugehörigkeit und das Gehalt sind für deren Entgeltcharakter sprechende Merkmale (vgl. dazu BAG vom 17.1.2023 - 3 AZR 220/22 in NZA 2023,355). Der Mischcharakter hat z.B. auch zur Folge, dass die Bewertung der Betriebszugehörigkeit nur zur Vergleichbarkeit von Teilzeit und Vollzeitkräften mit gleich langer Beschäftigungszeit führt (Münchner Handbuch Arbeitsrecht, 6. Aufl. 2024, § 206 Rn. 54 c). Die Orientierung am Entgeltcharakter gestattet eine unterschiedliche Bemessung des Ruhegeldsatzes für unter und für oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung liegende Gehaltsanteile (zweigeteilte Rentenformel). Die unterschiedliche Handhabung entspricht dem an der Höhe des Verdienstes orientierten Versorgungsbedarf (BAG v. 3.6.2020 - 3 AZR 480/18 in NZA 2020,1245).
Insgesamt hat die Einstufung als a) Entgeltleistung und b) Fürsorgeleistung für die Bewertung der Gültigkeit der einzelnen Klauseln in einer vom Arbeitgeber vorgegebenen Ruhegeldordnung Bedeutung. So ist z.B. zu prüfen, ob deren einzelne Regelungen Teilzeitkräfte oder Frauen verbotswidrig benachteiligen. Regelungen einer Ruhegeldordnung auf der Basis einer Betriebsvereinbarung oder eines Tarifvertrages lassen solche Verstöße nicht erwarten.
Vertragliche Anspruchsgrundlagen
Vom Fall der Entgeltumwandlung nach § 1a BetrAVG abgesehen trifft den Arbeitgeber keine Pflicht zur Einführung einer betrieblichen Altersversorgungszusage. Er kann dazu aber durch Gewährung von Steuervorteilen angeregt werden.
Versorgungszusagen können durch eine Betriebsvereinbarung, Gesamtzusage, Einzelvereinbarung oder betriebliche Übung begründet werden. In allen Fällen ist der Gleichbehandlungsgrundsatz in der Weise zu beachten, dass keine sachfremden Ausschlusskriterien festgelegt werden.
Nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts gilt bereits die "Zusage einer Versorgungszusage" ohne Bindung an ein Schriftformerfordernis als Versorgungszusage (vgl. dazu BAG v. 22.9.2020 - 3 AZR 433/ 19 in NZA 2021,577 ). Dieser Verschaffungsanspruch kann vor Eintritt des Versorgungsfalles weder verfallen, verjähren oder verwirkt werden (BAG v. 12.3.2024 - 3 AZR 150/23 in NZA 2024,1337).
Gewährt der Arbeitgeber eine betriebliche Altersversorgung als freiwillige Leistung, kann er entscheiden, in welcher Form er sie erbringen will. In den Vereinbarungen werden u. a. die Art der Versorgungsleistung, die Leistungsvoraussetzungen (z.B. Erfüllung einer Wartezeit, Bestehen des Arbeitsverhältnisses bei Eintritt des Versorgungsfalles) und die zuständige Stelle für die Leistungsgewährung geregelt.
Die Arbeitnehmer haben grundsätzlich keinen gesetzlichen Anspruch auf Beteiligung des Arbeitgebers an ihrer Leistung für eine betriebliche Altersversorgung. Die einzige Ausnahme von diesem Grundsatz regelt § 1a BetrAVG. Danach kann ein Arbeitnehmer von seinem Arbeitgeber eine sogenannte Entgeltumwandlung verlangen. Diese besteht gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 3 BetrAVG in der Umwandlung künftiger Entgeltansprüche in eine wertgleiche Anwartschaft auf Versorgungsleistungen. Der Arbeitgeber muss den Arbeitnehmer darauf nicht hinweisen (BAG v. 21.1.2014 - 3 AZR 807/11 in NZA 2014, 903). Einzelheiten zur Entgeltumwandlung sind in § 1a BetrAVG geregelt. Danach ist das Recht auf Umwandlung der künftigen Entgeltansprüche auf 4% der jeweiligen Beitragsbemessungsgrenze der allgemeinen Rentenversicherung begrenzt. Nach § 1a Abs. 1 a BetrAVG muss der Arbeitgeber 15% des umgewandelten Entgeltes zusätzlich als Arbeitgeberzuschuss in die Versorgungseinrichtung einzahlen, soweit er dadurch Sozialversicherungsbeiträge einspart.
Bis zur Höhe von 4% der jährlichen Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung sind die umgewandelten Entgeltbestandteile und Zuwendungen an Pensionsfonds, Pensionskassen oder Direktversicherungen beitragsfreigestellten Einkommen (§ 3 Nr. 63 Satz 1 und Satz 2 EStG).
Die Art des Durchführungsweges und des Anbieters legt auch in diesem Fall der Arbeitgeber fest. Eine Bestimmung in einem Leistungsplan einer Unterstützungskasse, nach der ein Anspruch auf eine betriebliche Altersversorgung nicht mehr erworben werden kann, wenn der Arbeitnehmer bei Eintritt in das Arbeitsverhältnis das 50. Lebensjahr vollendet hat, ist wirksam. Sie verstößt nicht gegen das Verbot der Diskriminierung wegen des Alters und bewirkt auch keine unzulässige Benachteiligung wegen des Geschlechts (BAG v. 12.11.2013 – 3 AZR 356/12).
Hinterbliebenenversorgung
Eine vom Arbeitgeber gestellte Ruhegeldordnung unterfällt der Klauselkontrolle der §§ 305 ff BGB. Diese Prüfung ergibt z.B. die Unwirksamkeit einer Klausel mit der nur der „jetzigen“ Ehefrau des Arbeitnehmers eine Hinterbliebenenversorgung zugesagt wird. Diese benachteiligt den Arbeitnehmer unangemessen. Diese Einschränkung der Zusage ist daher unwirksam (§ 307 Abs. 1 Satz 1 BGB). Das gilt aber nicht ohne weiteres für Versorgungszusagen, die vor dem 1.1.2002 erteilt wurden, da damals noch keine gesetzliche AGB-Kontrolle für Arbeitsverhältnisse bestand. Im Hinblick auf solche Alt-Zusagen ist deshalb eine ergänzende Vertragsauslegung erforderlich, um die entstehende Lücke zu schließen. Bei Versorgungszusagen, die vor dem 1. Januar 2002 erteilt wurden, führt dies dazu, dass lediglich dann, wenn die Ehe bereits während des Arbeitsverhältnisses bestand, Rechte geltend gemacht werden können (BAG v. 21.2.2017 - 3 AZR 297/15).
Gleichbehandlungsgrundsatz
Versorgungsverpflichtungen können nicht nur auf einer Versorgungszusage, sondern auch auf dem Grundsatz der Gleichbehandlung beruhen (§ 1b Abs.1 S.4 BetrAVG). Der arbeitsrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz gebietet dem Arbeitgeber, seine Arbeitnehmer oder Gruppen seiner Arbeitnehmer, die sich in vergleichbarer Lage befinden, bei der Anwendung einer von ihm selbst gegebenen Regel gleich zu behandeln. Werden für mehrere Arbeitnehmergruppen unterschiedliche Leistungen in der Altersversorgung vorgesehen, verlangt der Gleichbehandlungsgrundsatz, dass diese Unterscheidung sachlich gerechtfertigt ist. Keine Rechtfertigung für die Ungleichbehandlung ist der bloße Statusunterschied zwischen gewerblichen Arbeitnehmern und Angestellten. Die daran anknüpfende Unterscheidung beruht für sich genommen nicht auf sachgerechten Erwägungen. Eine unterschiedliche Behandlung dieser Arbeitnehmergruppen kann allerdings dann zulässig sein, wenn mit der Anknüpfung an den Statusunterschied gleichzeitig auf einen Sachverhalt abgestellt wird, der geeignet ist, die Ungleichbehandlung sachlich zu rechtfertigen. Der Differenzierungsgrund muss auf vernünftigen und einleuchtenden Erwägungen beruhen. Eine ungünstigere Behandlung von gewerblichen Arbeitnehmern gegenüber Angestellten bei der Berechnung der Betriebsrente im Rahmen einer Gesamtversorgung ist daher zulässig, wenn die Vergütungsstrukturen, die sich auf die Berechnungsgrundlagen der betrieblichen Altersversorgung auswirken, unterschiedlich sind. Dies ist etwa der Fall, wenn die gewerblichen Arbeitnehmer höhere Zulagen und Zuschläge erhalten als die Angestellten derselben Vergütungsgruppe (BAG v. 17.6.2014 - 3 AZR 757/12).
Durchführungswege
Die betriebliche Altersversorgung kann vom Arbeitgeber unmittelbar oder mittelbar über einen Versorgungsträger durchgeführt werden (§ 1b Abs. 2 bis 4). Folgende Möglichkeiten kommen in Betracht:
- Direktzusage: Mit einer Direktzusage geht der Arbeitgeber die Verpflichtung ein, dem Arbeitnehmer oder dessen Angehörigen ab Eintritt des Versorgungsfalles Leistungen in bestimmter Höhe zu zahlen. Die Direktzusage ist in der Regel eine allein vom Arbeitgeber finanzierte Form der Altersvorsorge (§ 1 Abs. 2 Nr. 1 BetrAVG).
- Direktversicherung: Eine Lebens- oder Rentenversicherung, die der Arbeitgeber mit einem Lebensversicherungsunternehmen zu Gunsten der Mitarbeiter als versicherte Personen abschließt (§ 1b Abs. 2 BetrAVG).
- Unterstützungskasse: Eine rechtlich selbstständige Einrichtung (z. B. eingetragener Verein oder GmbH), die von einem oder mehreren Arbeitgebern getragen wird und die Aufgabe hat, den vom Arbeitgeber den Arbeitnehmern zugesagte Leistungen der Alters-, Invaliditäts- und/oder Hinterbliebenenversorgung zu erbringen (§ 1b Abs. 4 BetrAVG)
- Pensionskasse: Eine vom Arbeitgeber unabhängige, rechtlich selbstständige Versorgungseinrichtung (Versicherung), die den Arbeitnehmern oder ihren Hinterbliebenen Rechtsansprüche auf Versorgungsleistungen einräumt. (§ 1b Abs. 3 BetrAVG)
- Pensionsfonds: Eine rechtsfähige Versorgungseinrichtung, die im Wege des Kapitaldeckungsverfahrens Leistungen im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung für einen oder mehrere Unternehmen zugunsten von Arbeitnehmern erbringt.
Der Arbeitgeber steht für die Erfüllung der von ihm zugesagten Leistungen auch dann ein, wenn die Durchführung nicht unmittelbar über ihn erfolgt (§ 1 Abs. 1 S. 2 u. 3 BetrAVG). Von dieser Einstandspflicht kann er sich nicht befreien (§ 17 Abs. 3 BetrAVG). Daher muss z. B. der Arbeitgeber eine Leistungskürzung gegenüber dem Arbeitnehmer ausgleichen, wenn eine Pensionskasse von ihrem satzungsmäßigen Recht Gebrauch macht, Fehlbeträge durch Herabsetzung ihrer Leistungen auszugleichen (BAG v. 19.6.2012 - 3 AZR 408/10). Verpflichtet sich der Arbeitgeber, die Versorgungsleistung im Versorgungsfall selbst zu erbringen, bildet er Rückstellungen (§ 1 Abs. 1 BetrAVG). Die Versorgungszusagen aus einer betrieblichen Altersversorgung gehen bei einem Betriebsübergang auf den neuen Inhaber über. Eine Spätehenklausel, die einem Arbeitnehmer Hinterbliebenenversorgung für seinen Ehegatten nur für den Fall zusagt, dass die Ehe vor Vollendung des 60. Lebensjahres des Arbeitnehmers geschlossen ist, benachteiligt den Arbeitnehmer unzulässig wegen des Alters und ist daher unwirksam (BAG v. 4.8.2015 - 3 AZR 137/13).
Entgeltumwandlung
Der Arbeitnehmer kann vom Arbeitgeber verlangen, dass von seinen künftigen Entgeltansprüchen bis zu 4% der jeweiligen Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenversicherung (2025 : 8.050,00 Euro Brutto-Monatsverdienst einheitlich für alle Bundesländer) durch Entgeltumwandlung für seine betriebliche Altersversorgung verwendet werden. Mindestens umzuwandeln ist ein Betrag von einem Hundertsechzigstel der Bezugsgröße nach § 18 Abs. 1 SGB IV. Diese wird in der Sozialversicherungsrechengrößen-VO jährlich neu festgesetzt. Sie beträgt für 2025 jährlich 44.940,00 Euro und umgerechnet monatlich 3.745,00 Euro einheitlich für alle Bundesländer. Dadurch wird sichergestellt, dass jeder Arbeitnehmer einen Zugang zur betrieblichen Altersversorgung erhält. Der Arbeitgeber kann als Durchführungsweg die Pensionskasse oder den Pensionsfonds vorgeben. Bietet er keinen dieser beiden Möglichkeiten an, kann der Arbeitnehmer die Durchführung über eine Direktversicherung verlangen. Die Durchführung des Anspruchs des Arbeitnehmers wird durch Tarifvertrag oder direkte Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer geregelt. Der Arbeitnehmer entscheidet über das Ob und die Höhe des umzuwandelnden Entgelts (§ 1a BetrAVG).
Anwartschaft
Bei der Anwartschaft handelt sich um eine Vorstufe des Ruhegeldanspruchs.
Einem Arbeitnehmer, dem Leistungen aus der betrieblichen Altersversorgung zugesagt worden sind, bleibt die Anwartschaft erhalten, wenn das Arbeitsverhältnis vor Eintritt des Versorgungsfalls, jedoch nach Vollendung des 21. Lebensjahres endet und die Versorgungszusage zu diesem Zeitpunkt mindestens drei Jahre bestanden hat (unverfallbare Anwartschaft). Ein Arbeitnehmer behält seine Anwartschaft auch dann, wenn er aufgrund einer Vorruhestandsregelung ausscheidet (§ 1b Abs. 1 BetrAVG).
Anpassung der laufenden Leistungen
Der Arbeitgeber ist verpflichtet, alle drei Jahre eine Anpassung der laufenden Leistungen der betrieblichen Altersversorgung zu prüfen und hierüber nach billigem Ermessen zu entscheiden. Dabei sind insbesondere die Belange des Versorgungsempfängers und die wirtschaftliche Lage des Arbeitgebers zu berücksichtigen (§ 16 Abs. 1 BetrAVG). Die Belange des Versorgungsempfängers bestehen in erster Linie in der Erhaltung des wirtschaftlichen Wertes der ihm zugesagten Versorgungsleistungen. Sie werden bestimmt durch
- den Anpassungsbedarf und
- die sog. „reallohnbezogene Obergrenze“ bestimmt.
Ausgangspunkt der Anpassungsentscheidung ist der Anpassungsbedarf des Versorgungsempfängers. Er richtet sich nach dem zwischenzeitlich eingetretenen Kaufkraftverlust. Danach wird die Entwicklung der Nettolöhne der aktiven Arbeitnehmer im Prüfungszeitraum berücksichtigt. Diese Nettolohnentwicklung bildet die (reallohnbezogene) Obergrenze der Anpassung. Für beide gilt derselbe Prüfungszeitraum. Dieser reicht vom individuellen Rentenbeginn bis zum aktuellen Anpassungsstichtag (BAG v. 19.6.2012 - 3 AZR 464/11). Die Anpassungsprüfungspflicht gilt als erfüllt, wenn die Anpassung nicht geringer ist als der Anstieg des Verbraucherpreisindexes für Deutschland oder der Nettolöhne vergleichbarer Arbeitnehmergruppen des Unternehmens im Prüfungszeitraum (§ 16 Abs. 2 BetrAVG). Sie entfällt, wenn
- der Arbeitgeber sich verpflichtet, die laufenden Leistungen jährlich um wenigstens eins vom Hundert anzupassen. Sie wird auch dann nicht verpflichtend, wenn
- die betriebliche Altersversorgung über eine Direktversicherung (§ 1b Abs. 2 BetrAVG) oder über eine Pensionskasse (§ 1b Abs. 3 BetrAVG) durchgeführt wird und ab Rentenbeginn sämtliche auf den Rentenbestand entfallende Überschussanteile zur Erhöhung der laufenden Leistungen verwendet werden.
- eine Beitragszusage mit Mindestleistung erteilt wurde (§ 16 Abs. 3 BetrAVG).
Insolvenzsicherung
Der Pensions-Sicherungs-Verein auf Gegenseitigkeit (PSVaG) ist der Träger der gesetzlichen Insolvenzsicherung im Bereich der betrieblichen Altersversorgung für die Bundesrepublik Deutschland und das Großherzogtum Luxemburg. Er unterliegt der Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (§ 14 Abs. 1 BetrAVG). Er tritt bei Versorgungssystemen ein, deren finanzielle Lebensfähigkeit vollständig oder ganz entscheidend von der Solvenz des Arbeitgebers abhängt. Dazu gehören Direktzusagen, Pensionsfonds, Unterstützungskassen sowie in bestimmten Fällen Direktversicherungen (§ 1b BetrAVG). Um die Insolvenzsicherung zu finanzieren, besteht für Arbeitgeber, die diese Formen betrieblicher Altersversorgung durchführen, eine öffentlich-rechtliche Beitragspflicht. Die Beitragshöhe wird jährlich neu festgelegt. Der Insolvenzsicherung unterliegen nicht Pensionskassen, weil für sie durch die Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht und das Versicherungsaufsichtsgesetz eine hinreichende Sicherheit im Hinblick auf die Erfüllbarkeit der Versorgungsverpflichtungen erreicht wird.
Ein Fall der Insolvenzsicherung der betrieblichen Altersversorgung liegt für Versorgungsempfänger (Rentner) und Versorgungsanwärter mit unverfallbarer Anwartschaft vor, wenn
- über das Vermögen oder über den Nachlass des Arbeitgebers das Insolvenzverfahren eröffnet worden ist,
- der Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens mangels Masse abgewiesen worden ist,
- bei vollständiger Beendigung der Betriebstätigkeit im Geltungsbereich ein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens nicht gestellt worden ist und ein Insolvenzverfahren offensichtlich mangels Masse nicht in Betracht kommt (§ 7 Abs. 1 S. 3 BetrAVG).
Versorgungsempfänger (einschließlich Hinterbliebener), deren Ansprüche aus einer unmittelbaren Versorgungszusage des Arbeitgebers (Direktzusage) nicht erfüllt werden, weil über das Vermögen des Arbeitgebers oder über seinen Nachlass das Insolvenzverfahren eröffnet worden ist, haben gegen den Träger der Insolvenzsicherung einen Anspruch in Höhe der Leistung, die der Arbeitgeber aufgrund der Versorgungszusage zu erbringen hätte, wenn das Insolvenzverfahren nicht eröffnet worden wäre. Entsprechendes gilt, wenn Leistungen aus einer Direktversicherung nicht gezahlt werden und eine Unterstützungskasse oder ein Pensionsfonds die vorgesehene Versorgung nicht erbringt (§ 7 Abs. 1 S. 1 u. 2 BetrAVG).