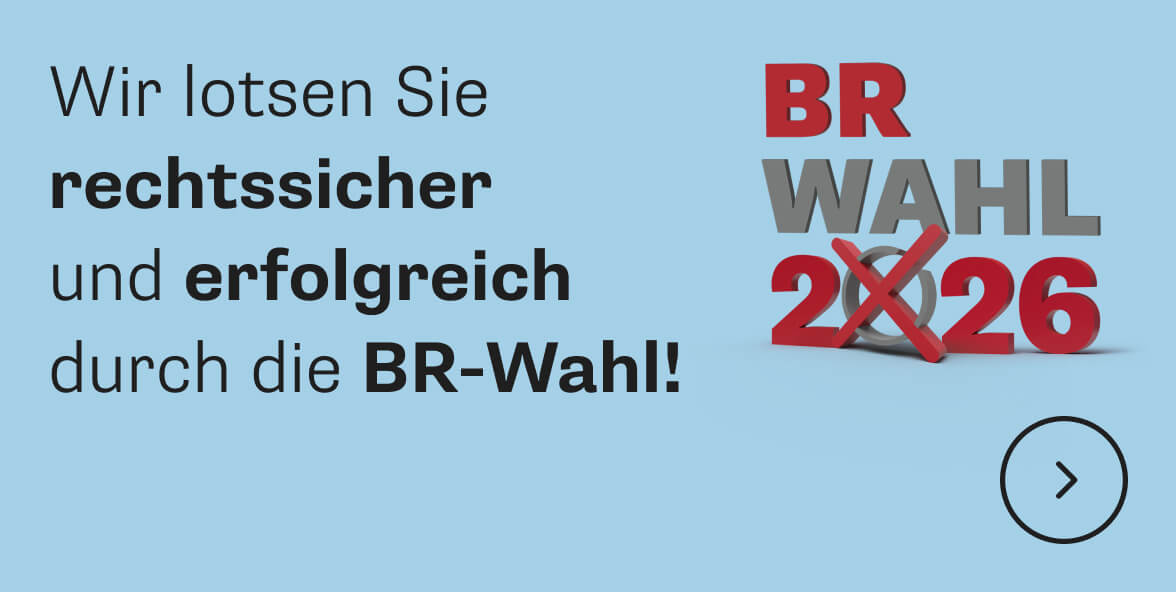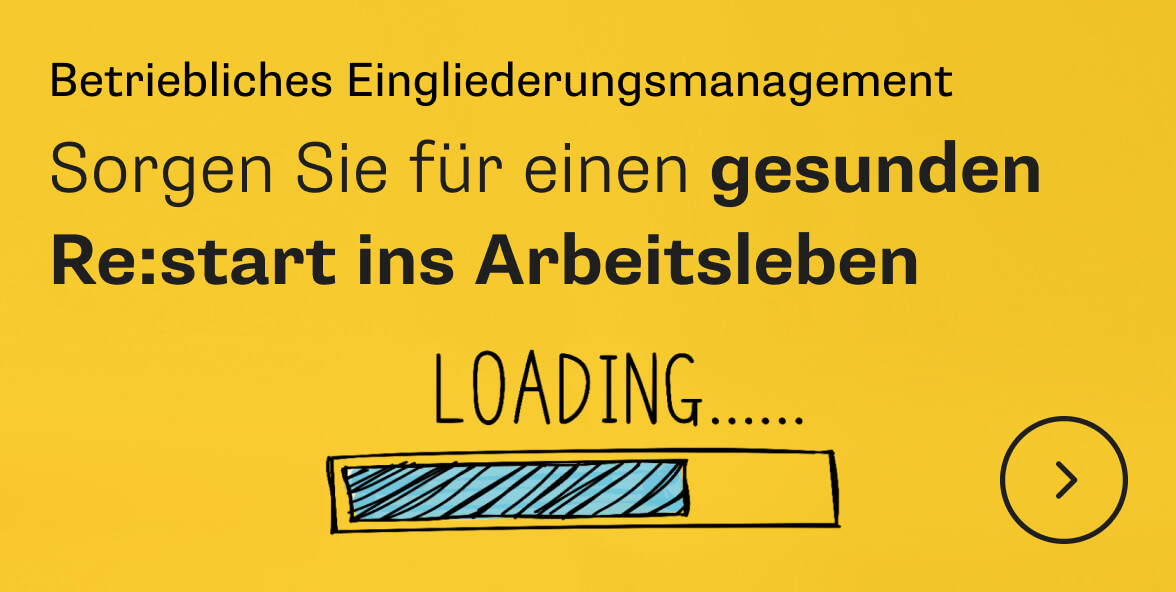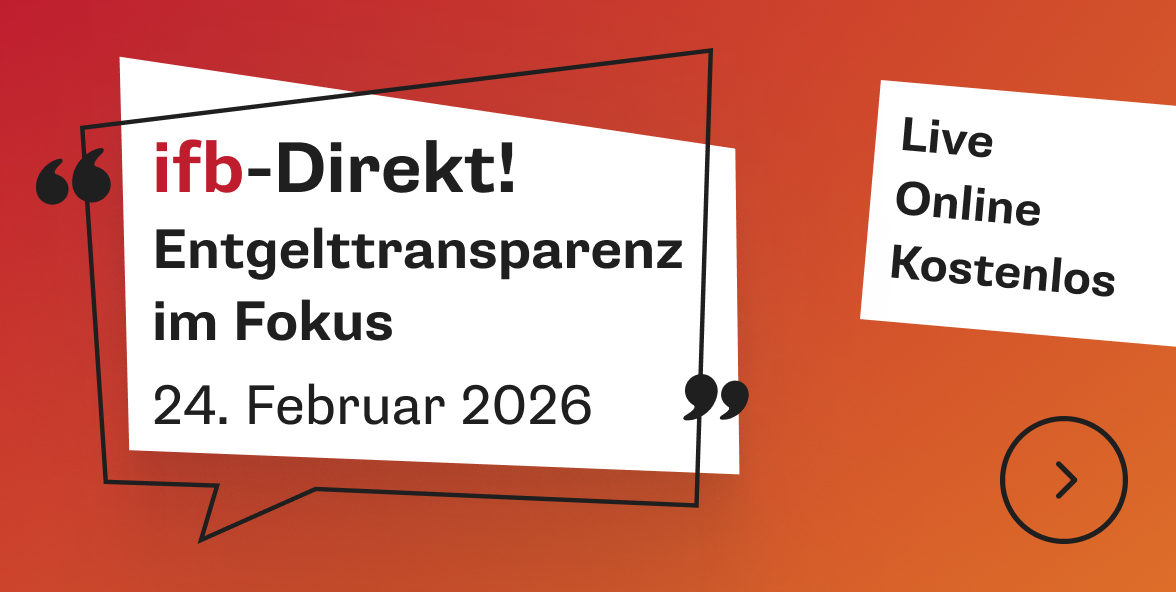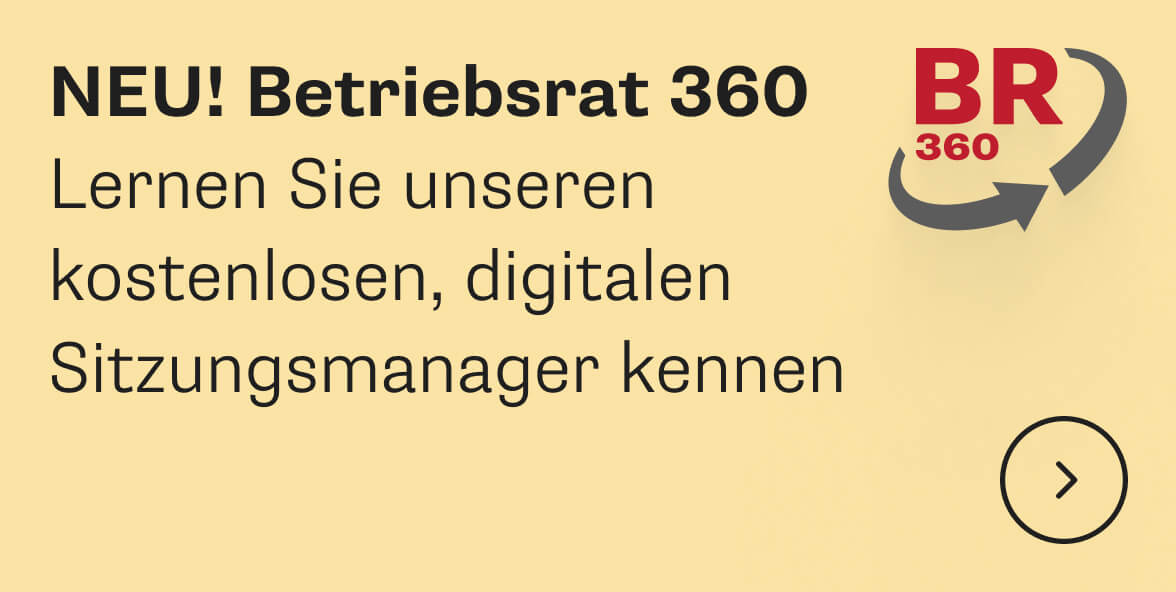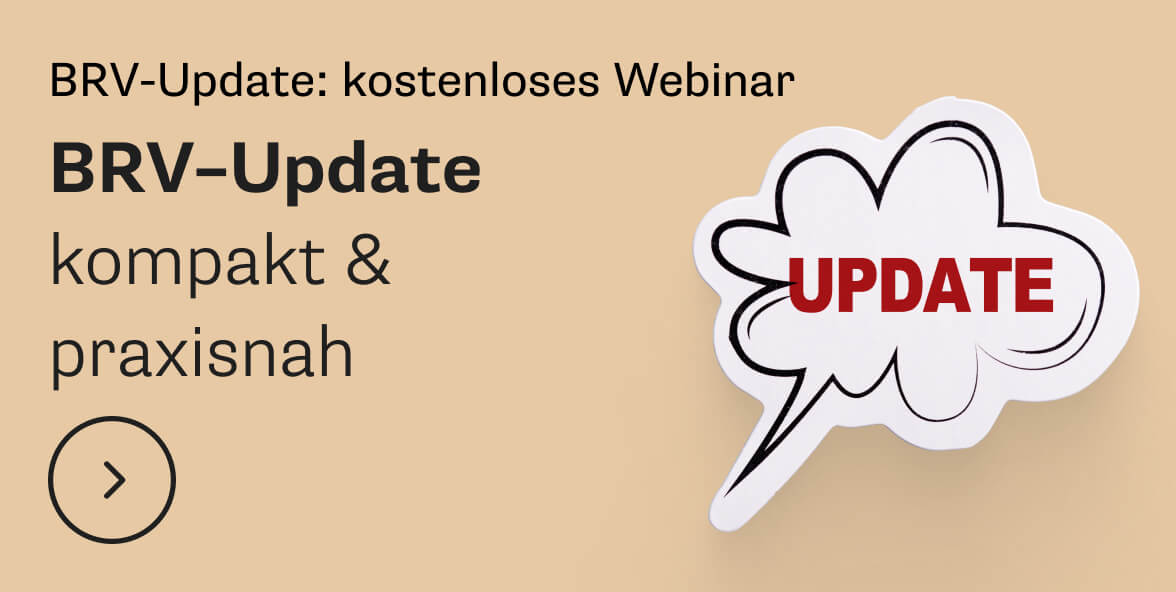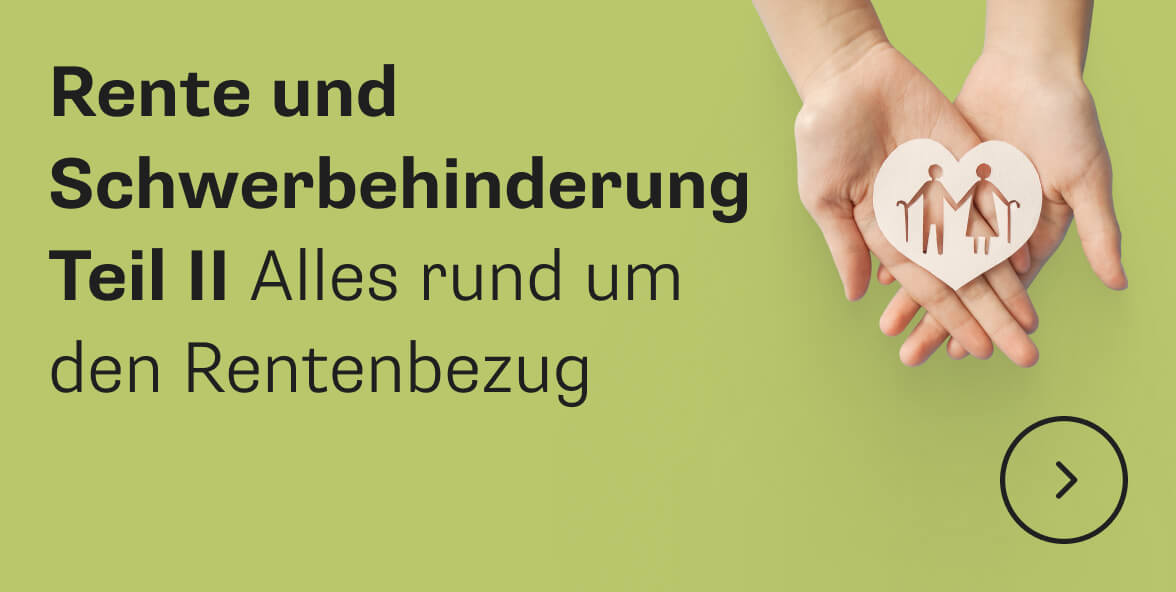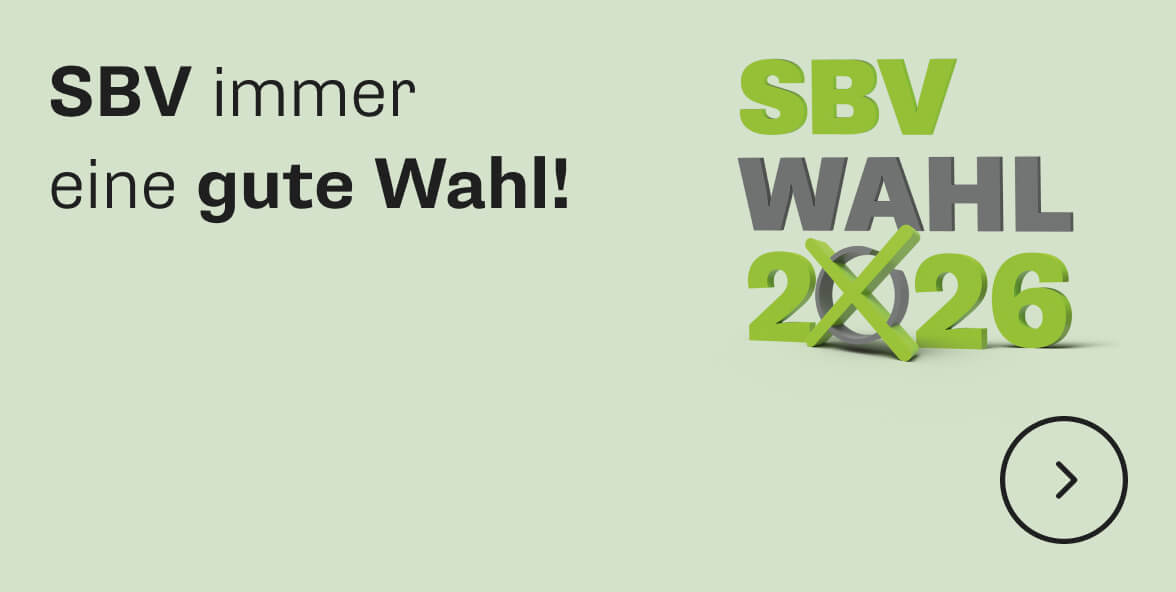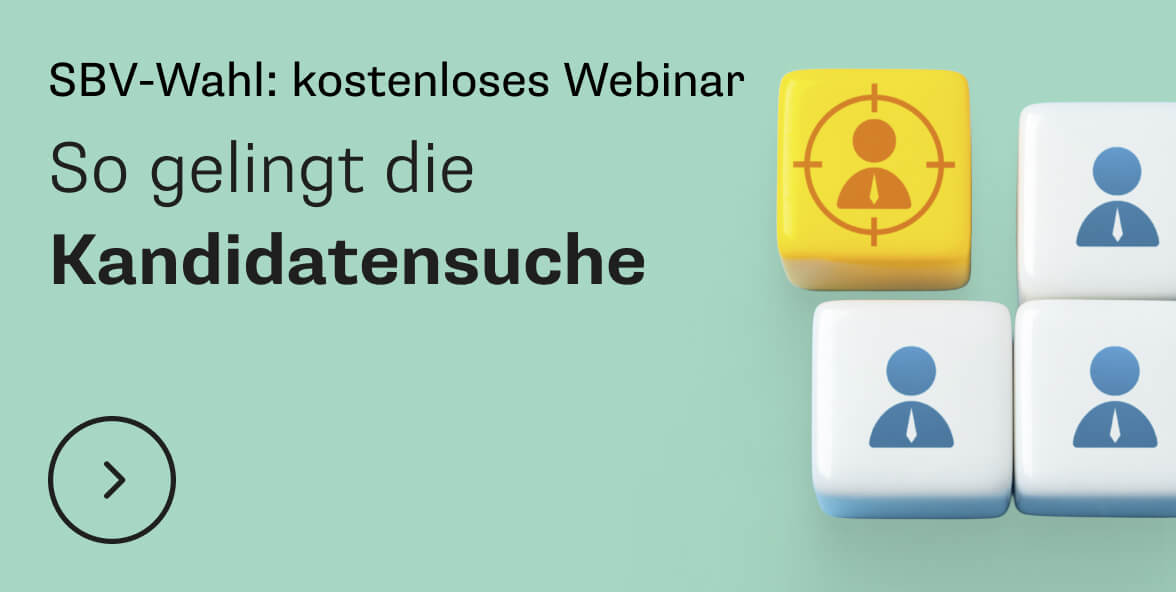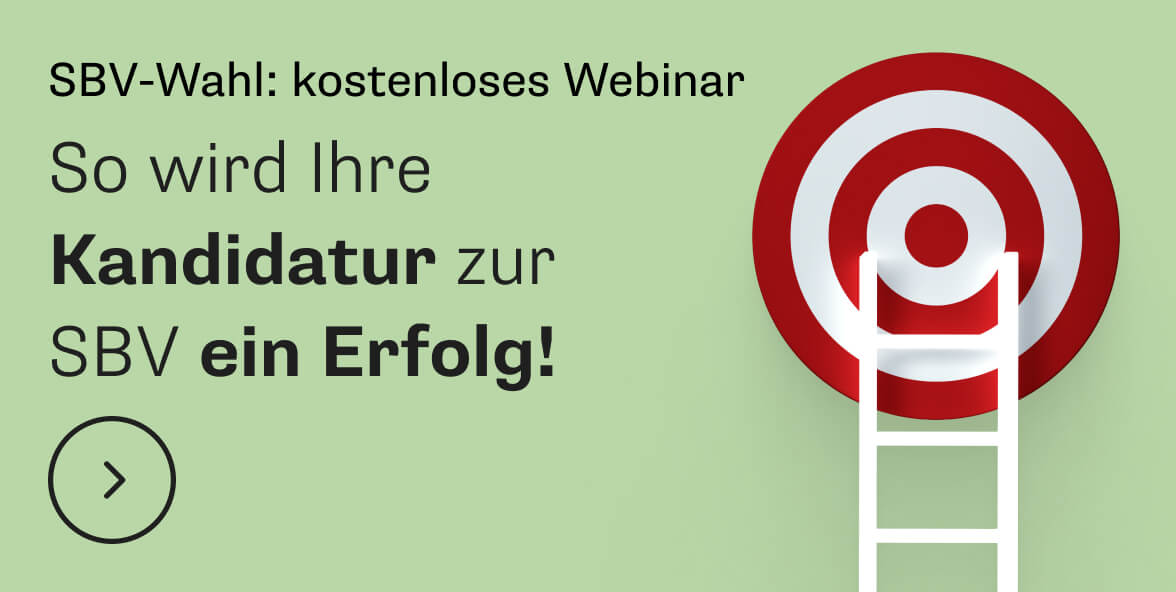Bezug zur Betriebsratsarbeit
Vorbemerkung
In den Betriebsrat können nur Arbeitnehmer gewählt werden. In dieser Eigenschaft sind sie zur Leistung der vertraglich vereinbarten Arbeit verpflichtet. Mit der Wahl in den Betriebsrat übernehmen sie zusätzliche Pflichten. Diese sind wie die Arbeitspflicht ebenfalls in der Arbeitszeit zu erfüllen. Aus dem Grund der zeitgleichen Erfüllungspflicht bedurfte es einer gesetzlichen Regelung zur Frage der vorrangig wahrzunehmenden Aufgabe.
Das Problem gleichzeitig anfallender Betriebsratsarbeit und Vertragsarbeit ist durch § 37 As. 2 BetrVG und § 38 BetrVG gelöst worden.
Dabei behandelt § 37 Abs. 2 BetrVG die fallbezogen anfallende Betriebsratsarbeit wie z.B. die Teilnahme an Sitzungen. Hier verdrängt die Betriebsratsarbeit die Arbeitspflicht. Das Betriebsratsmitglied ist von der Arbeitspflicht befreit, wenn und soweit es nach Umfang und Art des Betriebs zur ordnungsgemäßen Durchführung seiner Aufgaben erforderlich ist. Es muss aus organisatorischen Gründen nur eine möglichst frühzeitige, nicht unbedingt persönliche, Abmeldung vom Arbeitsplatz erfolgen.
Der nachfolgende § 38 BetrVG beruht auf der Erkenntnis eines Anstiegs der Betriebsratsaufgaben in Abhängigkeit von der Zahl der vom Betriebsrat zu vertretenden Arbeitnehmer. Der Gesetzgeber geht von der Annahme mit Vollzeitbedarf anfallender Betriebsratsarbeit ab einer Zahl von 200 Arbeitnehmern aus. Im zeitlichen Umfang von Vollzeitkräften sind dann ein oder mehrere Betriebsratsmitglieder völlig von ihrer beruflichen Tätigkeit freizustellen. Dieses Arbeitszeitvolumen kann auch auf mehrere in Teilzeit arbeitende Betriebsratsmitglieder aufgeteilt werden. Dadurch verlieren diese nicht ihre beruflichen Kenntnisse und den Anschluss an neue Entwicklungen.
Eine über die Mindeststaffel des § 38 BetrVG hinausgehende anlasslose weitere Freistellung von Betriebsratsmitgliedern kann deren nach § 78 BetrVG verbotene Begünstigung darstellen (ErfK 25. Aufl. 2025, BetrVG § 78 Rn. 9).
Zahl der nach § 38 BetrVG freizustellenden Betriebsratsmitglieder
Freistellungen sind ab einer Betriebsgröße von 200 Arbeitnehmern vorgesehen. Von ihrer beruflichen Tätigkeit sind mindestens freizustellen in Betrieben mit in der Regel
- 200 bis 500 Arbeitnehmern ein Betriebsratsmitglied,
- 501 bis 900 Arbeitnehmern 2 Betriebsratsmitglieder,
- 901 bis 1.500 Arbeitnehmern 3 Betriebsratsmitglieder,
- 1.501 bis 2.000 Arbeitnehmern 4 Betriebsratsmitglieder usw.
In Betrieben mit über 10.000 Arbeitnehmern ist für je angefangene weitere 2.000 Arbeitnehmer ein weiteres Betriebsratsmitglied freizustellen. Freistellungen können auch in Form von Teilfreistellungen oder der Freistellung von Teilzeitkräften erfolgen. Dann werden z.B. zwei Betriebsratsmitglieder je zur Hälfte ihrer Arbeitszeit freigestellt. Diese dürfen gemäß § 38 Abs. 1 Satz 4 BetrVG zusammengenommen nicht den Umfang der Freistellungen nach der vorstehenden Tabelle überschreiten.
Besondere Problem entstehen, wenn Teilzeitkräfte ganz oder teilweise freigestellt werden. Dann stellt sich die Frage, ob bei einer üblichen Wochenarbeitszeit von 40 Stunden eine Teilzeitkraft mit einer wöchentlichen Arbeitspflicht von 10 Stunden eine gesamte Freistellung verbraucht oder nur 25 % davon. Das hätte dann zur Folge, dass ein Rest von 75 % gleich 30 Stunden auf andere Betriebsratsmitglieder als Freistellung verteilt werden könnte.
Der Vollzeitbezug der Freistellungen ist weitgehend unstreitig (vgl. Fitting, BetrVG, 32. Aufl. 2024, § 38 Rn. 12b).
Die Berechnung des verbleibenden Freistellungsanspruch bei z.B. Teilfreistellungen von Teilzeitkräften kann Schwierigkeiten bereiten. Diese werden vermieden, wenn man die Zahl der dem Betriebsrat nach der Tabelle des § 38 Abs. 1 BetrVG zustehenden Freistellungen in einem ersten Schritt durch Multiplikation mit der Stundenzahl von Vollzeitkräften in ein Stundenvolumen umrechnet. Bei einem Anspruch auf drei Freistellungen würden dann bei einer 40- Stunden-Woche ein Stundenvolumen von 120 Stunden anfallen. Dieses kann dann im zweiten Schritt unschwer auf Ganztags-, Teilzeit- oder nur teilweise freizustellende Teilzeitkräfte verteilt werden. Von einem Arbeitszeitvolumen geht auch Weber in GK-BetrVG, 12. Aufl. 2022, § 38 Rn. 41 aus.
Die Zahl der dem Betriebsrat zustehenden Freistellungen richtet sich wie in § 9 BetrVG für die Zahl der Betriebsratsmitglieder nach der Zahl der "in der Regel" beschäftigten Arbeitnehmer. Allerdings kommt einer insoweit anzustellenden Prognose über eine künftige Personalentwicklung nicht dasselbe Gewicht wie in § 9 BetrVG zu. Denn Veränderungen der Personalstärke können nach § 38 BetrVG zu einer Anpassung der Zahl der Freistellungen nach oben oder unten führen. Es genügt daher zunächst, eine Berechnung der Zahl der freizustellenden Betriebsratsmitglieder an der für den Betrieb üblichen Personalstärke auszurichten.
Bei der Rechnung der Personalstärke zählen Teilzeitkräfte nach Köpfen. Zwei 50%-Teilzeitkräfte werden also als zwei und nicht als ein Arbeitnehmer in die Rechnung eingestellt.
Leiharbeitnehmer sind in die Berechnung gemäß § 14 Abs. 2 Satz 4 AÜG einzubeziehen. Sie müssen allerdings zur Gruppe der "in der Regel" beschäftigten Arbeitnehmer gehören. Insoweit kommt es nicht auf den möglicherweise häufig wechselnden konkreten Leiharbeitnehmer an. Maßgebend ist die Zahl der mit Leiharbeitnehmern üblicherweise besetzten Arbeitsplätze (siehe Fitting, BetrVG, 32. Aufl. 2024, § 38 Rn. 9a).
Die in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befindlichen Arbeitnehmer zählen bei der Berechnung der maßgeblichen Belegschaftsstärke nicht mit, weil sie nicht mehr in den Betrieb zurückkehren (BAG v. 16.4.2003 – 7 ABR 53/02).
Weitere Freistellungen
Die Schwellenwerte sind Mindestzahlen für Freistellungen. Durch Tarifvertrag oder Betriebsvereinbarung können anderweitige Regelungen über die Freistellung vereinbart werden (§ 38 Abs. 1 S. 4 BetrVG). Hält der Betriebsrat über die gesetzliche Mindeststaffel hinaus die Freistellung eines weiteren Betriebsratsmitglieds für die restliche Wahlperiode für erforderlich, muss er darlegen, dass diese Freistellung für die gesamte restliche Wahlperiode erforderlich ist. Er muss nachweisen, dass er nach Ausschöpfung seiner sonstigen personellen Möglichkeiten die anfallenden notwendigen Betriebsratsarbeiten nicht ordnungsgemäß verrichten kann. Dabei muss ersichtlich werden, dass die verfügbare Arbeitszeit der bereits generell freigestellten Mitglieder zusammen mit zeitweiser Arbeitsbefreiungen der übrigen Betriebsratsmitglieder nicht ausreicht, um sämtliche erforderlichen Betriebsratsaufgaben ordnungsgemäß erfüllen zu können (BAG v. 26.7.1989 - 7 ABR 64/88). Da die gesetzliche Freistellungsstaffelung vom Gesetzgeber so bemessen ist, dass urlaubs-, krankheits- und schulungsbedingte Abwesenheitszeiten der freigestellten Betriebsratsmitglieder berücksichtigt sind, kann eine entsprechende Ersatzfreistellung bei Verhinderung eines freigestellten Betriebsratsmitglieds nur bei konkreter Darlegung der Erforderlichkeit verlangt werden. Der Betriebsrat ist bei zeitweiliger Abwesenheit freigestellter Betriebsratsmitglieder gehalten, die von ihnen zu erledigenden Betriebsratsaufgaben von den übrigen Mitgliedern des Betriebsrats wahrnehmen zu lassen, soweit das nach Art und Umfang der Aufgabe im Einzelfall erforderlich ist (BAG v. 9.7.1997 - 7 ABR 17/96). Auch die zeitweilige Verhinderung eines freigestellten Betriebsratsmitglieds in Folge seiner Zugehörigkeit zum Gesamtbetriebsrat rechtfertigt in der Regel keine weitere Freistellung (BAG v. 12.2.1997 – 7 ABR 40/96).
Änderung der Belegschaftsstärke
Erhöht sich die Zahl der regelmäßig beschäftigten Arbeitnehmer während der Amtszeit des Betriebsrats nicht nur vorübergehend über den nächsten Schwellenwert, so hat er Anspruch auf entsprechende Erhöhung der Zahl der freizustellenden Betriebsratsmitglieder. Ist die ursprüngliche Freistellungswahl nach den Grundsätzen der Verhältniswahl erfolgt, sind in diesem Fall alle freizustellenden Betriebsratsmitglieder neu zu wählen (Fitting, BetrVG, 32. Aufl. 2024, § 38 Rn. 16). Das gilt nur dann nicht, wenn alle Betriebsratsmitglieder beschließen, die zusätzlich freizustellenden Betriebsratsmitglieder in der Form der Mehrheitswahl zu wählen.
Die Wahl des zusätzlich freizustellenden Betriebsratsmitglieds kann jedoch immer isoliert erfolgen, wenn die Wahl der bisherigen freizustellenden Mitglieder als Mehrheitswahl durchgeführt wurde (BAG v. 20.4.2005 – 7 ABR 47/04).
Im Falle des nicht nur vorübergehenden Rückgangs der Belegschaftsstärke auf eine Zahl unterhalb des bisherigen Schwellenwerts, ist die Zahl der Freigestellten entsprechend zu verringern. Die Anpassung bei Verringerung an die gesunkene Belegschaftsstärke kann entweder durch Abberufung eines der bisher freigestellten Betriebsratsmitglieder erfolgen. Möglich ist aber auch eine Aufhebung der Freistellung des zuletzt berücksichtigten Betriebsratsmitglieds. Die Abberufung bedarf einer qualifizierten Mehrheit von drei Vierteln der Stimmen.
Wahl
Beratung mit dem Arbeitgeber
Die freizustellenden Betriebsratsmitglieder werden nach Beratung mit dem Arbeitgeber vom Betriebsrat aus seiner Mitte in geheimer Wahl gewählt (§ 38 Abs. 2 S. 1 BetrVG). An der Beratung mit dem Arbeitgeber nimmt der gesamte Betriebsrat teil. Denn jedes Betriebsratsmitglied könnte für eine Freistellung kandidieren. Dieser Umstand erklärt ein verständliches Interesse an der Beratung mit dem Arbeitgeber. Eine Beratung nur einzelner Betriebsratsmitglieder mit dem Arbeitgeber genügt daher nicht (BAG v. 29.4.1992 – 7 ABR 74/91).
Durch die Beratung soll dem Arbeitgeber Gelegenheit gegeben werden, vor der Wahl etwaige aus betrieblichen Gründen bestehende Bedenken gegen die Freistellung bestimmter Betriebsratsmitglieder zu erheben. zu können. Unterbleibt die Beratung mit dem Arbeitgeber, führt dies nicht zur Unwirksamkeit der Wahl zur Freistellung von Betriebsratsmitgliedern. Die Unterlassung kann jedoch die Anfechtung der Wahl rechtfertigen.
Wahlgrundsätze
Der Betriebsratsvorsitzende leitet die Wahl. Die Wahl ist geheim durchzuführen. Deshalb sind Stimmzettel zu verwenden. Diese müssen nicht zwingend vorgedruckt sein. Jedes Betriebsratsmitglied kann einen Wahlvorschlag vorlegen. Darin kann jedes Betriebsratsmitglied vorgeschlagen werden. Ein Betriebsratsmitglied kann sich auch selbst vorschlagen. Vor Abgabe des Wahlvorschlags ist das Einverständnis des betroffenen Betriebsratsmitglieds zur Freistellung einzuholen (BAG v. 11.3.1992 - 7 ABR 50/91). Die Zahl der vorzuschlagenden Bewerber ist nicht vorgeschrieben. Ist mehr als ein Betriebsratsmitglied freizustellen und wird mehr als ein eigenständiger Wahlvorschlag eingereicht, ist jeder Wahlvorschlag als Liste anzusehen. Es findet dann Verhältniswahl (Listenwahl) statt (§ 38 Abs. 2 S. 1 BetrVG).
Das Ergebnis der Abstimmung ist nach dem in § 15 WO beschriebenen d'Hondt`schen Höchstzahlverfahren auszuwerten. Eine Berücksichtigung des Geschlechts in der Minderheit ist bei der Wahl des möglicherweise einzigen freizustellenden Betriebsratsmitgliedes nicht möglich. Sie ist deshalb auch generell nicht vorgesehen.
Ist nur ein freizustellendes Betriebsratsmitglied zu wählen oder wird nur ein Wahlvorschlag eingereicht, ist Mehrheitswahl (Personenwahl) vorgesehen (§ 38 Abs. 2 S. 2 BetrVG). Sie kann entweder in getrennten Wahlgängen durchgeführt werden, bei dem über jeden Bewerber in einem Wahlgang gesondert abgestimmt wird. Zulässig ist aber auch ein gemeinsamer Wahlgang, bei dem auf jedem Stimmzettel so viele Namen angekreuzt/aufgeschrieben werden, wie freizustellende Betriebsratsmitglieder zu wählen sind. Im Übrigen ist bei dem Verfahren zur Ermittlung der Gewählten § 22 Abs. 2 Satz 2 u. 3 WO entsprechend anzuwenden.
Pattsituationen können bei allen Wahlverfahren durch Stichwahl oder Losentscheid behoben werden.
Der Anspruch auf Freistellung ist ein Kollektivanspruch des Betriebsrats. Erst nach der Wahl erwirbt das gewählte Betriebsratsmitglied einen Individualanspruch auf Freistellung von der Arbeitspflicht. Dieser Anspruch ist vom Arbeitgeber als dem Träger des Rechts auf die Arbeitsleistung zu erfüllen. Die Erklärung muss nicht ausdrücklich abgegeben werden. Sie gilt als ausgesprochen, wenn der Arbeitgeber der Freistellung der ihm namentlich mitgeteilten ausgewählten Arbeitnehmer nicht aktiv widerspricht und auch die Einigungsstelle innerhalb der ihm zustehenden Anrufungsfrist von zwei Wochen nicht einschaltet ( Fitting, BetrVG, 32. Aufl. 2024, § 38 Rn. 59).
Hält der Arbeitgeber eine Freistellung für sachlich nicht vertretbar, so kann er innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach der Bekanntgabe die Einigungsstelle anrufen. Der Spruch der Einigungsstelle ersetzt die Einigung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat. Ruft der Arbeitgeber die Einigungsstelle nicht an, so gilt sein Einverständnis mit den Freistellungen nach Ablauf der zweiwöchigen Frist gemäß § 38 Abs. 2 Satz 7 BetrVG als erteilt.
Wahlanfechtung
Die Wahl freizustellender Betriebsratsmitglieder kann in entsprechender Anwendung von § 19 BetrVG innerhalb von zwei Wochen nach Abschluss der Wahl von einem oder mehreren Betriebsratsmitgliedern angefochten werden. Die Anfechtungsfrist beginnt grundsätzlich mit der Feststellung des Wahlergebnisses durch den Betriebsrat. Ausnahmsweise kann es für den Beginn der Anfechtungsfrist auf die tatsächliche Kenntnisnahme der Wahl und dem Wahlergebnis ankommen. Das ist der Fall, wenn ein Betriebsratsmitglied wegen Verhinderung nicht an der Betriebsratssitzung teilgenommen hat, in der die Wahl durchgeführt wurde. Der spätere Fristbeginn gilt allerdings nur für das verhinderte Betriebsratsmitglied, nicht für die übrigen Betriebsratsmitglieder (BAG v. 20.4.2005 - 7 ABR 44/04).
Anfechtungsberechtigt ist jedes Betriebsratsmitglied. Der Arbeitgeber ist nur anfechtungsberechtigt, wenn der Betriebsrat mehr freigestellte Betriebsratsmitglieder gewählt hat als gesetzlich vorgesehen sind, z.B. weil der Betriebsrat die Belegschaftsstärke falsch ermittelt hat.
Die Nichtigkeit einer Wahl des freizustellenden Betriebsratsmitglieds kann fristungebunden immer und von jedem Arbeitnehmer oder dem Arbeitgeber geltend gemacht werden kann. Wegen dieser weitreichenden Folge kann nur in seltenen Ausnahmefällen von einer nichtigen Wahl ausgegangen werden.
Amtsniederlegung, Abberufung
Die Freistellung setzt Freiwilligkeit voraus. Daher kann ein freigestelltes Betriebsratsmitglied sein Einverständnis zur Freistellung jederzeit widerrufen z. B., um durch die Freistellung den Anschluss an neuere berufliche Entwicklungen nicht zu verlieren.
Freigestellte können aus dieser Funktion vom Betriebsrat abberufen werden. Die Abberufung eines freigestellten Betriebsratsmitglieds, das nach den Grundsätzen der Verhältniswahl gewählt wurde, erfolgt durch Beschluss des Betriebsrats. Der Beschluss ist in geheimer Abstimmung zu fassen. Er bedarf einer Mehrheit von drei Vierteln der Stimmen der Mitglieder des Betriebsrats. (§ 38 Abs. 2 S. 8 i. V. m. § 27 Abs. 1 S. 5 BetrVG).
Für die Abberufung eines nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl für die Freistellung ausgewählten Betriebsratsmitgliedes reicht die einfache Mehrheit (Mehrheit der anwesenden Mitglieder). In diesem Falle ist die geheime Stimmabgabe gesetzlich nicht vorgeschrieben.
Das betroffene Mitglied darf an der Beschlussfassung teilnehmen. Denn es handelt sich um eine Organisationsentscheidung des Gremiums.
In Anwendung der entsprechenden Vorschrift zur Abwahl von Ausschussmitgliedern (§ 27 Abs. 1 BetrVG) ist die Neuwahl des nachrückenden Betriebsratsmitglieds ohne die vorangehende Abberufung des früher wirksam gewählten Ausschussmitglieds nichtig (Fitting, BetrVG, 32. Aufl. 2024 § 38 Rn. 75). Es empfiehlt sich aus Gründen der Verfahrensvereinfachung, dieses zur Niederlegung seines Amtes zu bewegen. Dieser Schritt ist dem freigestellten Betriebsratsmitglied insbesondere bei Vorliegen von Sachgründen zumutbar, z.B. Änderung des benötigten Fachwissens für die Aufgabenerfüllung.
Nachwahl eines freizustellenden Betriebsratsmitglieds
Bei dauerhaftem Ausscheiden eines Betriebsratsmitglieds aus der Freistellung ist für die Nachfolge § 25 Abs. 2 BetrVG betreffend das Nachrücken von Ersatzmitgliedern in den Betriebsrat entsprechend anzuwenden. Dafür kommt es darauf an, in welchem Wahlverfahren die freizustellenden Betriebsratsmitglieder gewählt wurden.
- Wahl nach den Grundsätzen der Verhältniswahl
- das Ersatzmitglied ist der Liste des ausgeschiedenen Freigestellten zu entnehmen. Ist diese Liste erschöpft, findet kein "Listensprung"auf die Liste mit der nächsten unberücksichtigten Höchstzahl statt. Diese in § 25 Abs. 2 Satz 2 BetrVG verankerte Regelung findet keine Anwendung (so BAG v. 21.2.2018 - 7 ABR 54/16 in NZA 2018, 951 Rn. 15). Es hat vielmehr eine Nachwahl nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl zu erfolgen
- Wahl nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl
- hier bestimmt sich die Reihenfolge der Ersatzfreistellungen nach der Höhe der erreichten Stimmenzahlen.
Bei vorübergehender Verhinderung durch z. B. Urlaub, Krankheit, Elternzeit kommt keine Ersatzfreistellung in Betracht.
Rechte und Pflichten
Status, Arbeitsort und Aufgaben
Für freigestellte Betriebsratsmitglieder gelten, abgesehen von der Arbeitspflicht, alle Rechte und Pflichten aus ihrem Arbeitsverhältnis z.B. für die Urlaubsgewährung, Die Teilnahme an der Zeiterfassung, die Anwesenheitspflicht für die Dauer der vereinbarten Arbeitszeit.
Das freigestellte Betriebsratsmitglied hat sich während der Dauer der vereinbarten Arbeitszeit im Betrieb zur Erledigung von Aufgaben des Betriebsrats aufzuhalten (BAG v. 10.7.2013 - 7 ABR 22/12). Betriebsratsmitglieder, die vor ihrer Freistellung außerhalb des Betriebs z. B. im Außendienst oder auf Montage tätig waren, wechseln mit der Freistellung grundsätzlich ihren Arbeitsort (BAG v. 28.8.1991 – 7 ABR 46/90).
Für die Erledigung von Betriebsratsarbeit gelten die zeitlichen Grenzen des Arbeitszeitgesetzes nicht. Denn der Arbeitgeber hätte keine Möglichkeit, dessen Einhaltung durchzusetzen.
Nimmt das freigestellte Betriebsratsmitglied andere als betriebsverfassungsrechtliche Aufgaben wahr, so kann dies eine grobe Amtspflichtverletzung sein (§ 23 Abs. 1 BetrVG).
Ab- und Rückmeldepflicht
Freigestellte Mitglieder des Betriebsrats sind verpflichtet, sich beim Arbeitgeber unter Angabe der voraussichtlichen Dauer der Betriebsratstätigkeit abzumelden, wenn sie außerhalb des Betriebes erforderlichen Betriebsratsaufgaben nachgehen.
Dem Arbeitgeber wird ein -fragwürdiges - berechtigtes Interesse an der Kenntnis zugebilligt, dass eines oder mehrere der freigestellten Betriebsratsmitglieder als Ansprechpartner für mitbestimmungspflichtige Angelegenheiten vorübergehend nicht im Betrieb zur Verfügung stehen. Die Information soll dazu dienen, sich im Bedarfsfall an andere freigestellte, ggf. auch an nicht freigestellte Betriebsratsmitglieder wenden zu können.
Diese Begründung erscheint sehr fragwürdig. Die Gefahr des Missbrauches eines solchen Rechtes ist nicht zu verkennen.
Dagegen hat der Arbeitgeber kein berechtigtes Interesse daran, dass freigestellte Betriebsratsmitglieder den Ort der beabsichtigten Betriebsratstätigkeit vor dem Verlassen des Betriebes bekanntgeben. Er benötigt diese Information nicht, um während der Abwesenheit der freigestellten Betriebsratsmitglieder Dispositionen treffen zu können. Diese Angabe kann zwar geboten sein, wenn das Betriebsratsmitglied den Arbeitgeber auf die Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der außerhalb des Betriebes wahrgenommenen Betriebsratstätigkeit in Anspruch nimmt. Damit soll es dem Arbeitgeber ermöglicht werden, die Erforderlichkeit der außerhalb des Betriebes wahrgenommenen Betriebsratsaufgaben prüfen zu können. Dazu genügt es jedoch, dass der Arbeitgeber nachträglich über den Ort und ggf. über weitere Einzelheiten der Betriebsratstätigkeit in Kenntnis gesetzt wird. (BAG v. 24.2.2016 - 7 ABR 20/14).
Arbeitszeit
Freigestellte Betriebsratsmitglieder haben grundsätzlich die betriebsübliche Arbeitszeit einzuhalten. Besteht im Betrieb eine Regelung über gleitende Arbeitszeit, so sind die freigestellten Betriebsratsmitglieder berechtigt, ihre Betriebsratstätigkeit innerhalb der Gleitarbeitszeit so wahrzunehmen, wie es ihnen zur Aufgabenerfüllung am zweckdienlichsten erscheint. Arbeitet ein Betrieb in Wechselschicht, so sind die freigestellten Betriebsratsmitglieder nicht verpflichtet, ihre frühere Schichteinteilung beizubehalten. Sie können ihre Betriebsratstätigkeit vielmehr so einteilen, wie es ihrer Ansicht nach zur ordnungsgemäßen Durchführung ihrer Aufgaben am besten erscheint. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, auch freigestellte Betriebsratsmitglieder an der betrieblich geregelten elektronischen Zeiterfassung teilnehmen zu lassen und dort Anfang und Ende der täglichen Arbeitszeit zu erfassen (BAG v. 10.7.2013 - 7 ABR 22/12).
Arbeitsentgelt und Dienstwagen
Auch für das freigestellte Betriebsratsmitglied gilt das Lohnausfallprinzip, wonach Betriebsratsmitglieder von ihrer beruflichen Tätigkeit ohne Minderung des Arbeitsentgelts zu befreien sind (§ 37 Abs. 2 BetrVG). Neben der Grundvergütung haben Betriebsratsmitglieder Anspruch auf Zahlung aller Zuschläge und Zulagen, die sie ohne Arbeitsbefreiung verdient hätten. Auch die Möglichkeit, einen im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses überlassenen Dienstwagen für private Fahrten zu nutzen, ist Bestandteil des Arbeitsentgelts. Das von der beruflichen Tätigkeit vollständig befreite Betriebsratsmitglied hat Anspruch auf Überlassung eines Firmenfahrzeugs zur privaten Nutzung, wenn ihm der Arbeitgeber vor der Freistellung zur Erfüllung seiner dienstlichen Aufgaben ein Firmenfahrzeug zur Verfügung gestellt hat und der Arbeitnehmer dieses auf Grund einer vertraglichen Vereinbarung auch privat nutzen durfte. Der Zeitraum, in dem das freigestellte Betriebsratsmitglied das Fahrzeug privat nutzen kann, ändert sich durch die Befreiung als Betriebsratsmitglied nicht. Die private Fahrzeugnutzung ist ihm nach wie vor nur außerhalb der Arbeitszeit möglich. Während der Arbeitszeit ist das Betriebsratsmitglied an der Privatnutzung des Fahrzeugs durch seine Betriebsratstätigkeit gehindert. Der Arbeitgeber könnte über die Nutzung des Fahrzeugs während dieser Zeit anderweitig verfügen. Eine Vereinbarung der Arbeitsvertragsparteien, wonach die Gebrauchsüberlassung des Fahrzeugs entschädigungslos endet, wenn eine Freistellung von der Dienstpflicht keine Tätigkeit mit dienstlicher Fahrzeugnutzung mehr vorsieht, ist wegen des Verbots der Entgeltminderung (§ 37 Abs. 2 BetrVG) und wegen des Benachteiligungsverbots (§ 78 S. 2 BetrVG) unwirksam (BAG v. 23.6.2004 – 7 AZR 514/03). Das Arbeitsentgelt eines freigestellten Betriebsratsmitglieds darf einschließlich eines Zeitraums von einem Jahr nach Beendigung der Amtszeit nicht geringer bemessen werden als das Arbeitsentgelt vergleichbarer Arbeitnehmer mit betriebsüblicher beruflicher Entwicklung (§ 37 Abs. 4 BetrVG).
Tätigkeitsschutz
Soweit nicht zwingende betriebliche Notwendigkeiten entgegenstehen, dürfen freigestellte Mitglieder des Betriebsrats einschließlich eines Zeitraums von einem Jahr nach Beendigung der Amtszeit nur mit Tätigkeiten beschäftigt werden, die den Tätigkeiten vergleichbarer Arbeitnehmer mit betriebsüblicher beruflicher Entwicklung gleichwertig sind (§ 37 Abs. 5 BetrVG). Um freigestellten Betriebsratsmitgliedern nach Beendigung der Freistellung eine möglichst schnelle und an die betriebsübliche Entwicklung vergleichbarer Arbeitnehmer angepasste Wiedereingliederung in das Berufsleben zu ermöglichen, hat der Arbeitgeber einem freigestellten Betriebsratsmitglieder im Rahmen der Möglichkeiten des Betriebs Gelegenheit zu geben, eine wegen der Freistellung unterbliebene betriebsübliche berufliche Entwicklung innerhalb eines Jahres nach Beendigung der Freistellung nachzuholen (§ 38 Abs. 4 BetrVG). Ein Arbeitnehmer, der während der letzten 5 Jahre seines insgesamt knapp 12 Jahre andauernden Arbeitsverhältnisses zur Ausübung seines Betriebsratsamts vollständig von der Arbeitsverpflichtung freigestellt war, kann vom Arbeitgeber nicht verlangen, dass dieser Umstand in einem qualifizierten Arbeitszeugnis verschwiegen wird. Insbesondere hat er auch keinen Anspruch auf Erteilung zweier Arbeitszeugnisse – mit und ohne Erwähnung der Freistellung -, von denen er wahlweise Gebrauch machen könnte (LAG Köln v. 06.12.2012, 7 Sa 583/12).