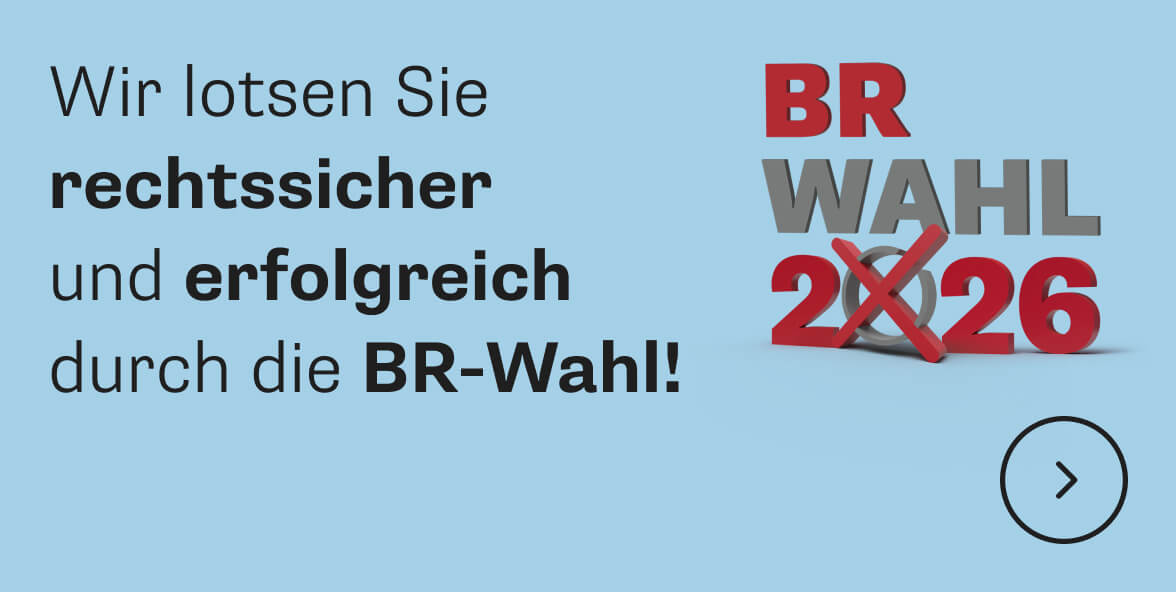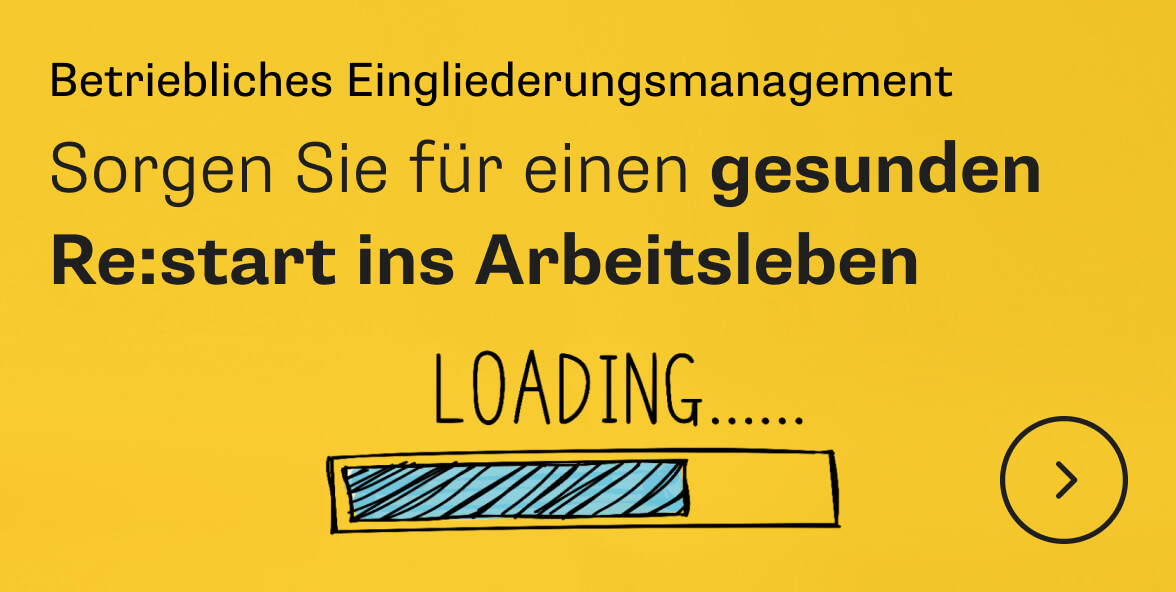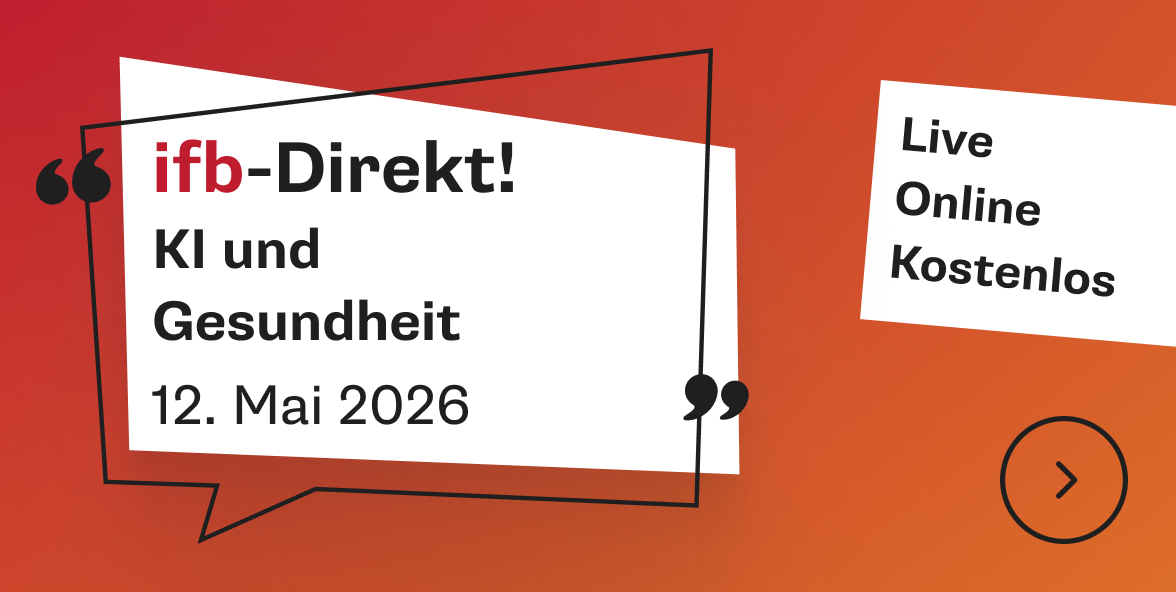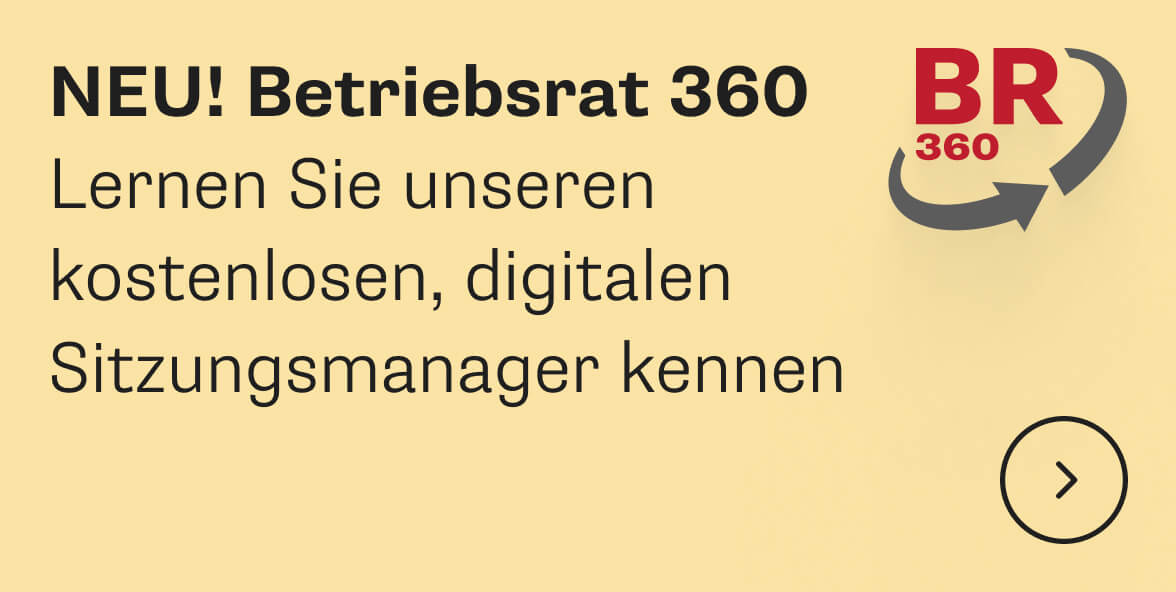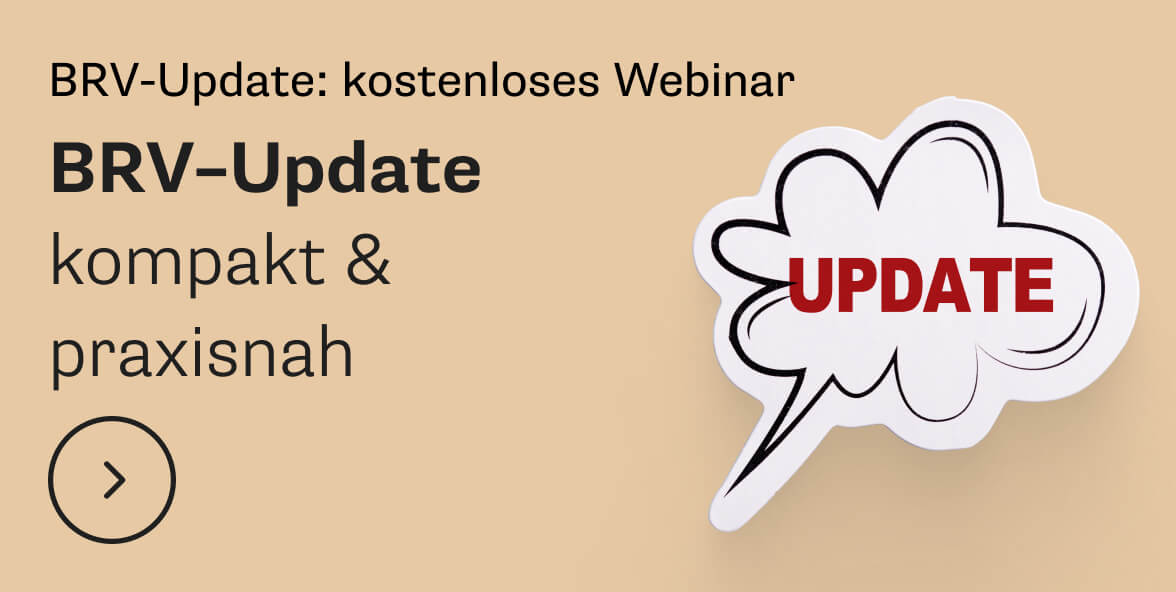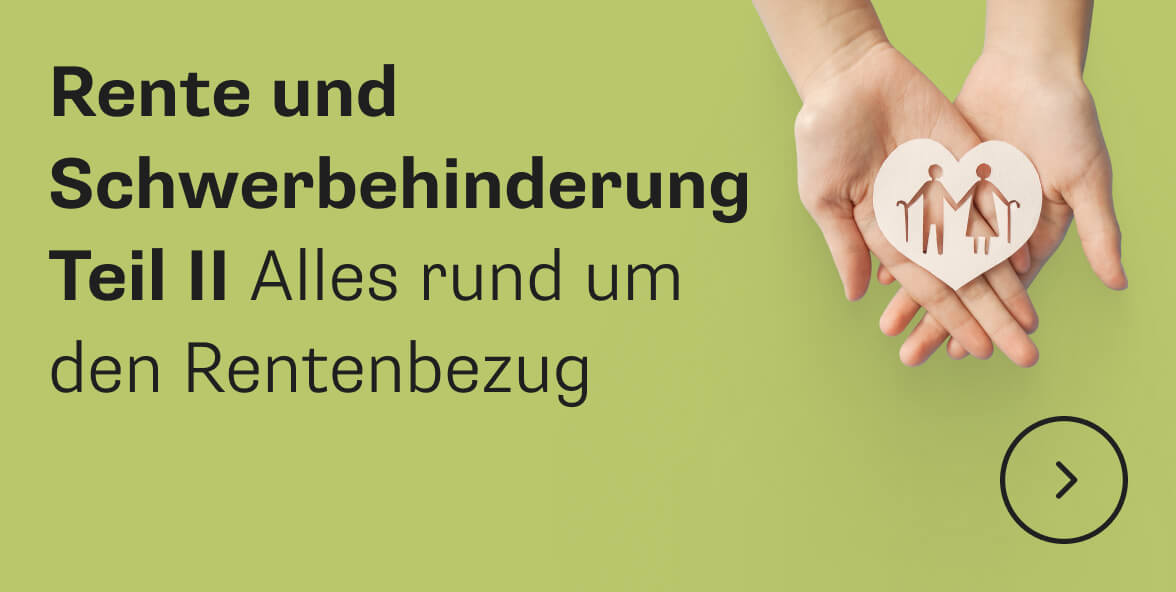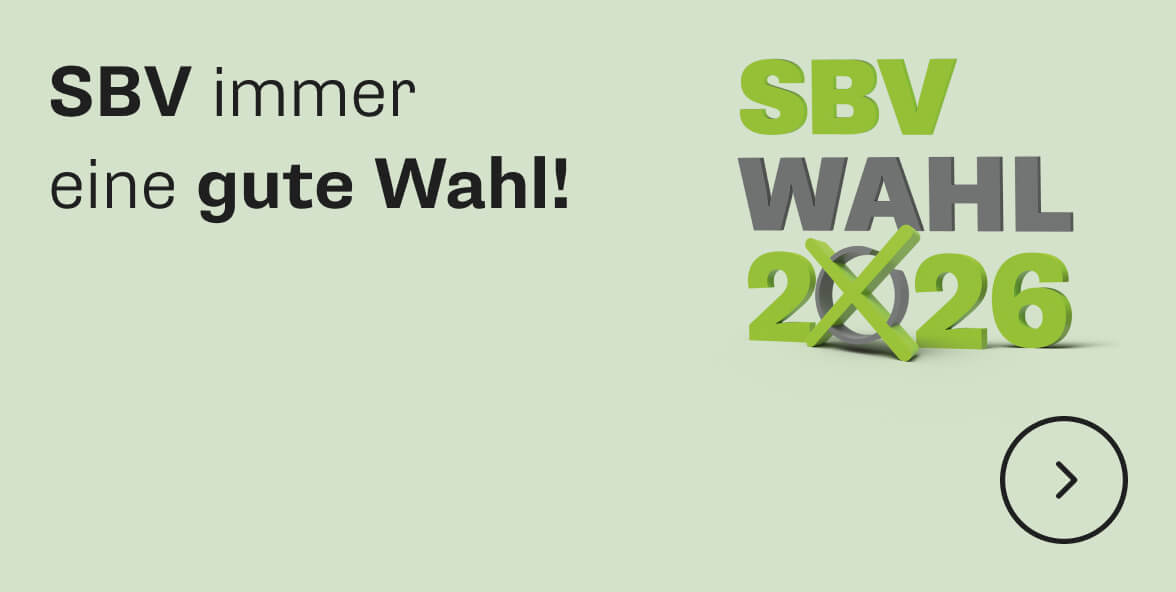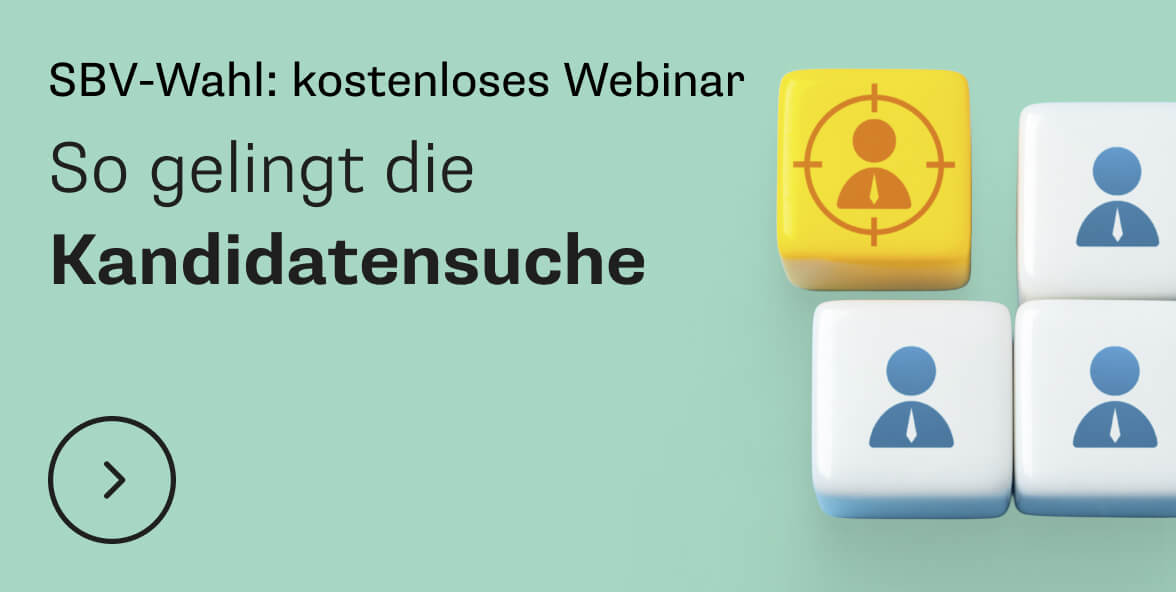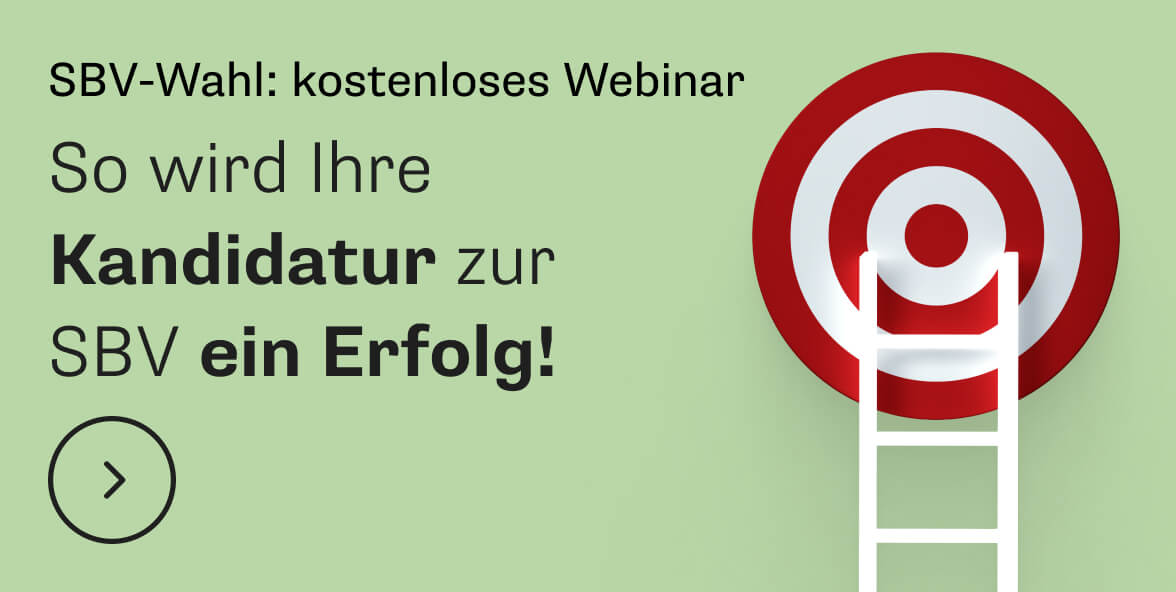Wer einen Brand legt, muss die Folgen tragen. Das ist wahrscheinlich auch jedem juristischem Laien klar: Bei vorsätzlicher Brandstiftung drohen nicht nur Schadensersatzforderungen und eine fristlose Kündigung, sondern sogar eine Freiheitsstrafe. So auch hier: Das Amtsgericht Freiburg im Breisgau verurteilte den zündelnden Azubi zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren (Urteil vom 25.07.2022, 21 Ls 516 Js 10276/21). Fazit: Finger weg vom Zündholz, Frust hin oder her!
Schäden und Missgeschicke im Alltag
Doch wie sieht es im normalen Arbeitsalltag aus, wenn mal etwas schiefgeht? Können hier Schadensersatzansprüche auf Azubis zukommen?
Grundsätzlich gilt: Für die Haftung von Auszubildenden greifen die allgemeinen Regeln des Arbeitsrechts (§ 10 Abs. 2 BBiG, § 276 BGB). Das bedeutet: Azubis können für Schäden haften, die sie rechtswidrig und schuldhaft verursachen.
Beispiele:
- Du beschädigst als Azubis mutwillig eine Maschine oder andere Einrichtungen des Betriebs.
- Du verursachst vorsätzlich bei einem Kollegen einen Schaden.
Was heißt das in der Praxis?
Der Auszubildende haftet grundsätzlich voll bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, bei mittlerer Fahrlässigkeit kann eine Schadensteilung greifen und bei leichter Fahrlässigkeit entfällt idR die Haftung.
Wichtig: Dabei sind immer die Gesamtumstände des Einzelfalles abzuwägen! Im Zentrum steht also immer die Frage nach dem Verschulden. Die Unterscheidung ist aber oft schwierig, da die Grenzen zwischen den einzelnen Fahrlässigkeitsstufen fließend sind. Zudem müssen Betrieb und Ausbilder den Azubi ordentlich einweisen und beaufsichtigen.
Wann gilt ein Haftungsausschluss?
Es lohnt sich auch ein Blick in § 105 Abs. 1 Satz 1 SGB VII. Danach gilt: Wenn ein Personenschaden nicht vorsätzlich und bei einer „betrieblichen Tätigkeit“ verursacht wurde, greift der Haftungsausschluss nach §105 Abs.1 Satz 1 SGB VII, sodass keine Schmerzensgeld- oder Schadenersatzansprüche gegenüber dem Azubi geltend gemacht werden können. Betrieblich veranlasst bedeutet, dass dem Schädiger die Tätigkeit übertragen wurde oder dass sie von ihm im Betriebsinteresse erbracht wurde.
Fazit: Darüber sprechen
Fehler können passieren – und das ist in einer Ausbildung völlig normal. Wichtig ist für alle Azubis: Wenn dich mal etwas frustriert oder überfordert, sprich mit jemandem darüber. Das können deine Eltern sein, ein Kollege, der dir vertraut ist, oder – ganz offiziell – der Betriebsrat oder die JAV, die genau dafür da sind.