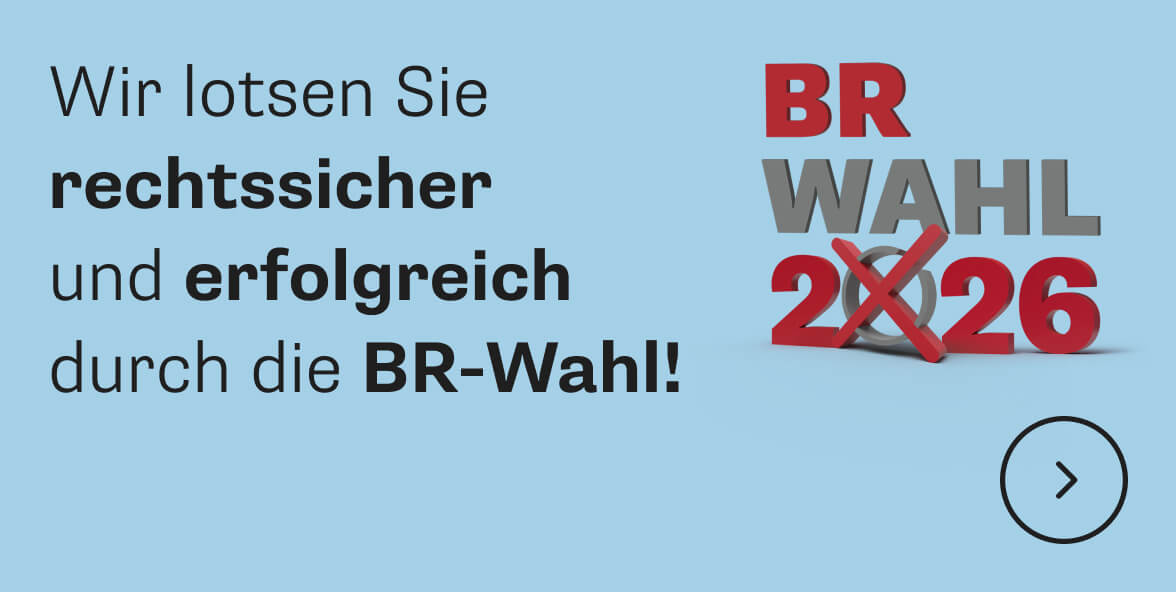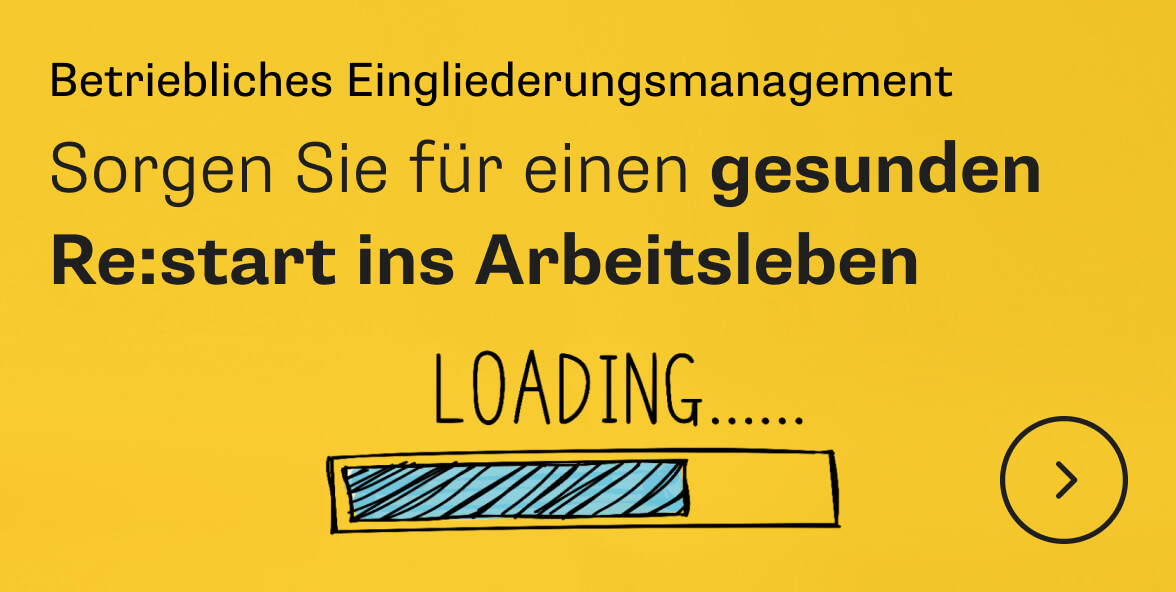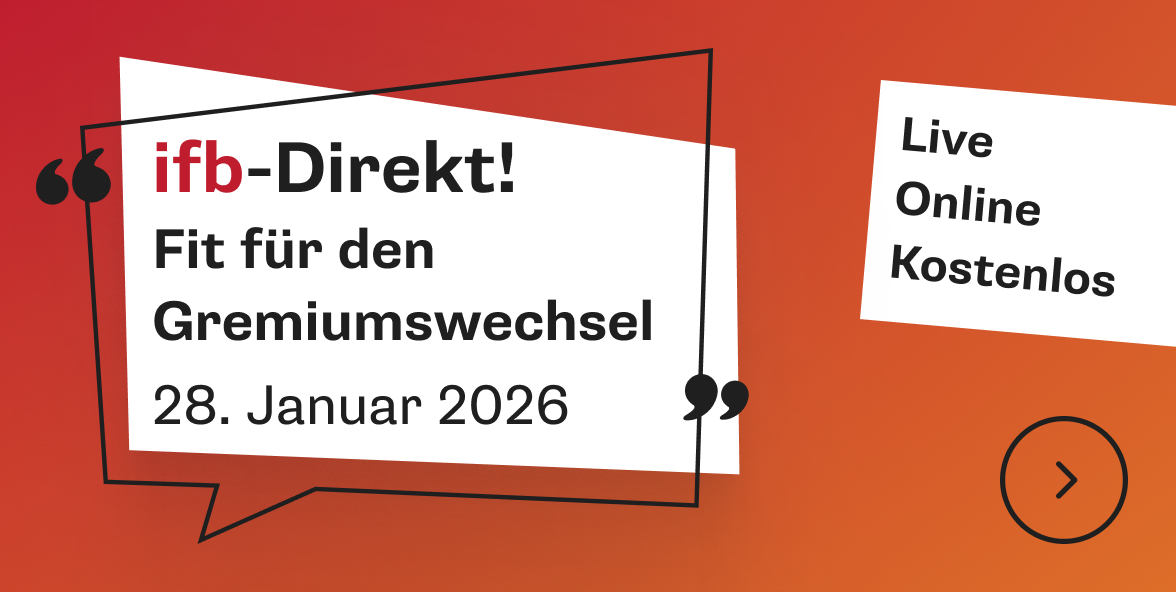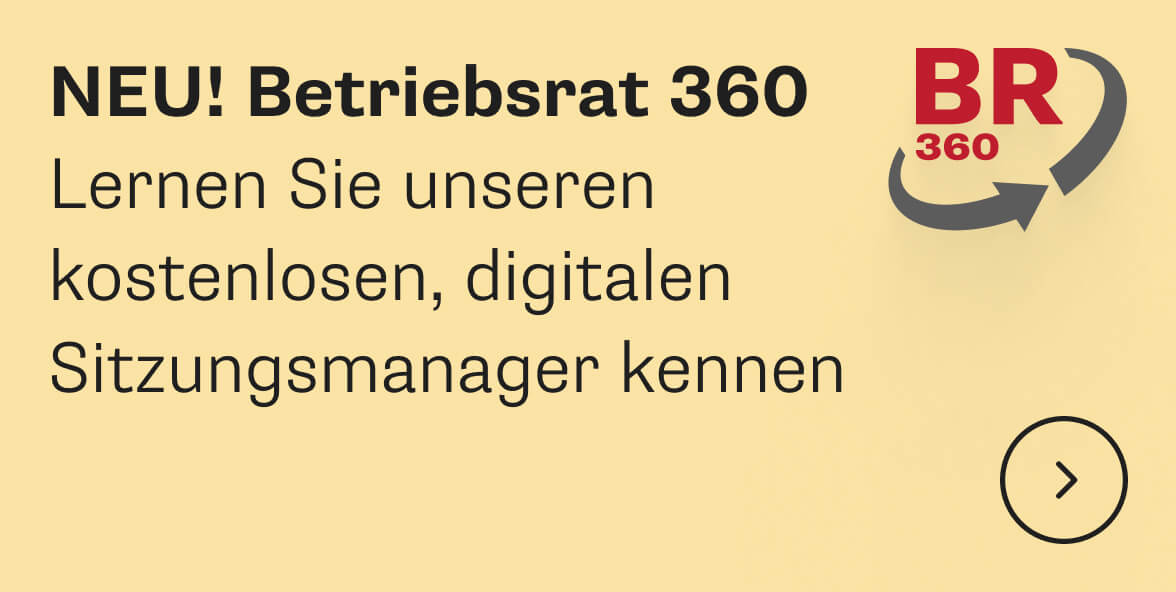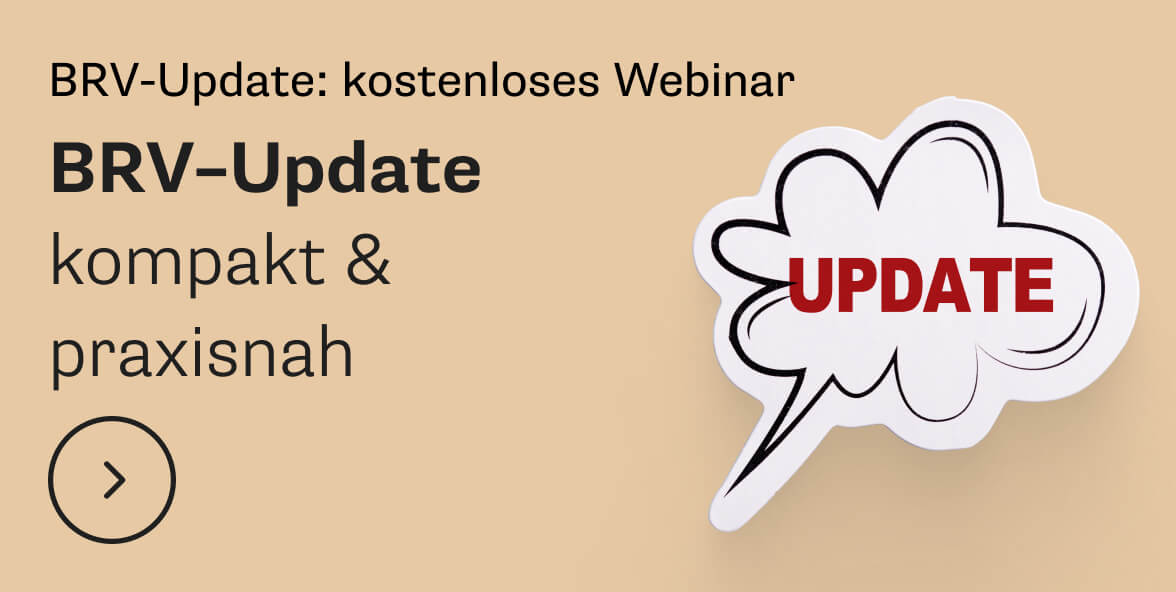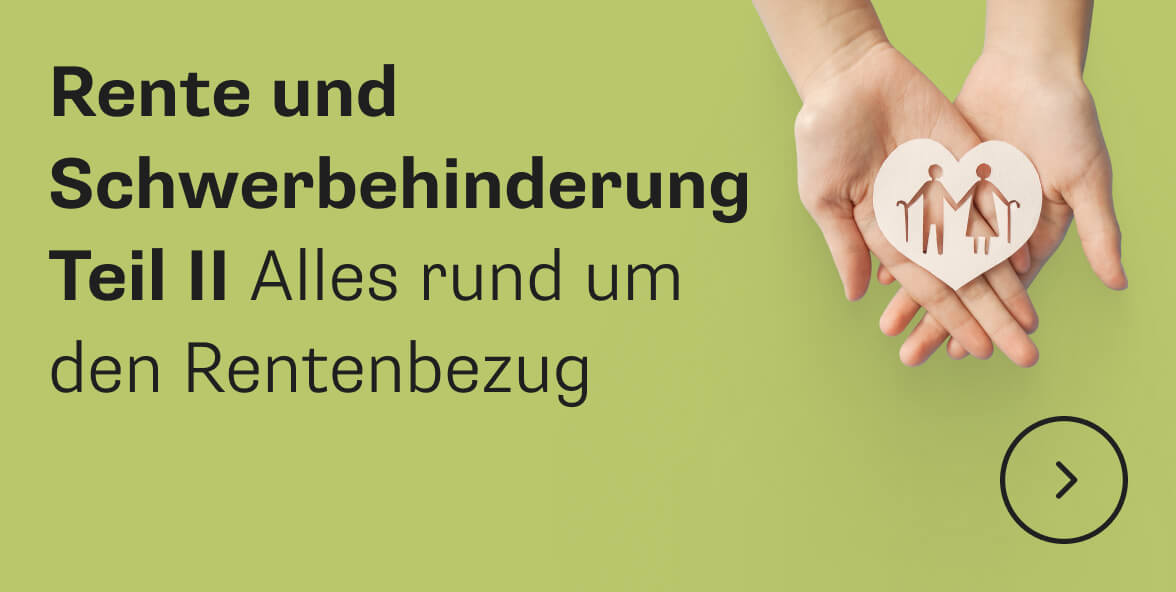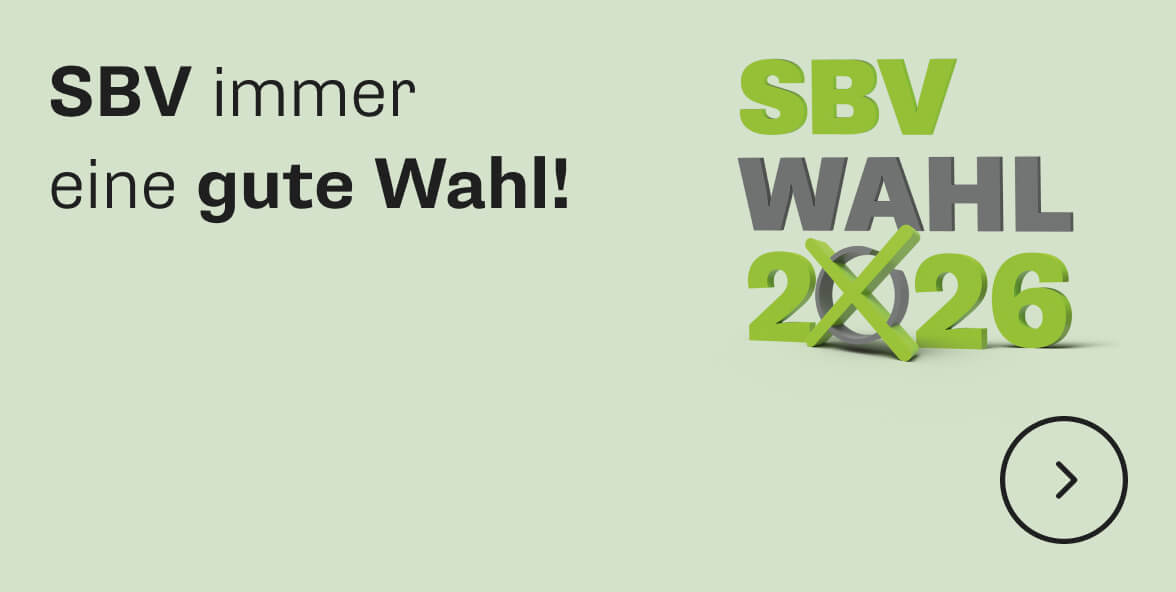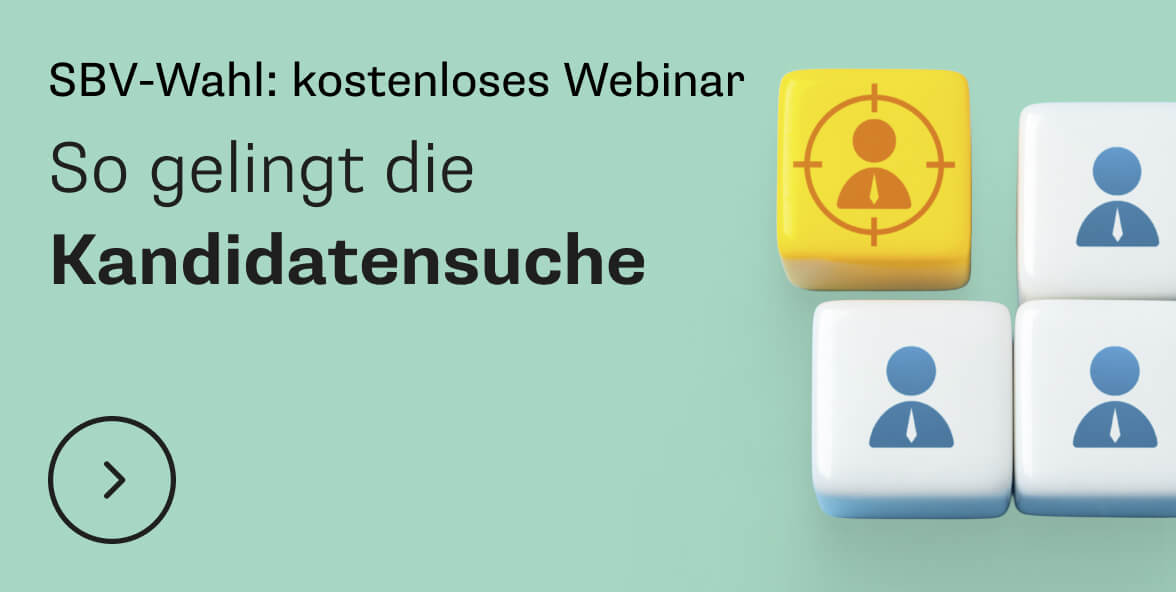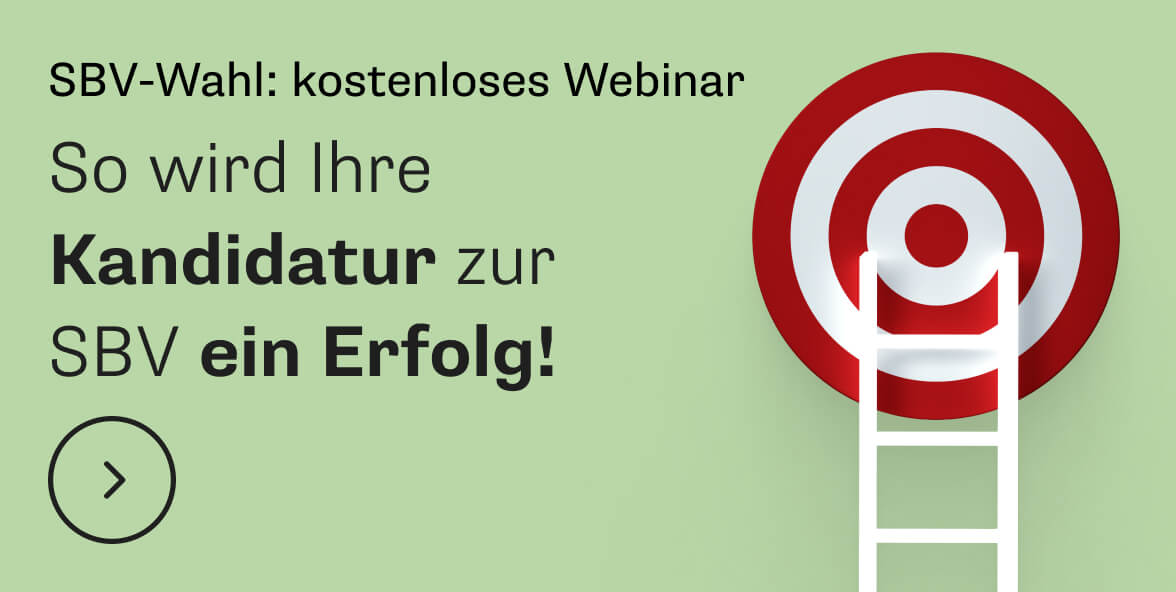Betriebsrat
Betriebsrat
Themen für Betriebsräte
Seminare und Wissen für erfolgreiche Betriebsratsarbeit
Themen für BR-Ausschüsse
Komplexe BR-Aufgaben effizient lösen – mit gut organisierten Ausschüssen
Lernformate
Für jeden Lerntyp etwas dabei: Seminare, Ausbildungen, Fachtagungen und mehr
Schulungsanspruch
Wissen ist Ihr gutes Recht: Ihr Anspruch auf Fortbildungen als Betriebsrat
Rechtsprechung und Lexikon
Aktuelle Gerichtsurteile und wichtige Begriffe für Ihre BR-Praxis
Services für Betriebsräte
Wir sind Ihr Bildungspartner – vor, während und nach dem Seminarbesuch!
Themen für Betriebsräte
Themen für BR-Ausschüsse
Lernformate
Schulungsanspruch
So kommen Sie als Betriebsrat sicher zum Seminar!
Rollen und Funktionen
Häufige Fragen
Rechtsprechung und Lexikon
Aktuelle Rechtsprechungen
Services für Betriebsräte
BRV
BRV
Themen für BRV
Seminare und Wissen für Vorsitzende, Stellvertreter und Freigestellte
Themen für BR-Ausschüsse
Komplexe BR-Aufgaben effizient lösen – mit gut organisierten Ausschüssen
Lernformate
Lernen, wie es zu Ihnen passt: In Präsenz, Online oder als Inhouse-Veranstaltung
Schulungsanspruch
Ihr Anspruch auf Fortbildung als Betriebsratsvorsitzender
Rechtsprechung und Lexikon
Aktuelle Gerichtsurteile und wichtige Begriffe für Ihre BR-Praxis
Services für BRV
Wir sind Ihr Bildungspartner – vor, während und nach dem Seminarbesuch!
Themen für BRV
Themen für BR-Ausschüsse
Lernformate
Schulungsanspruch
Sicher zum Seminar
Rollen und Funktionen
Häufige Fragen
Rechtsprechung und Lexikon
Aktuelle Rechtsprechungen
Services für BRV
SBV
SBV
Themen für die SBV
Seminare und Wissen für erfolgreiche SBV-Arbeit
Lernformate
Für jeden Lerntyp etwas dabei: Seminare, Fachtagungen und mehr
Schulungsanspruch
Ihr Anspruch auf Fortbildung als Schwerbehindertenvertretung
Rechtsprechung & Lexikon
Aktuelle Gerichtsurteile und wichtige Begriffe für Ihre SBV-Arbeit
Services für SBV
Wir sind Ihr Bildungspartner – vor, während und nach dem Seminarbesuch!
Themen für die SBV
Lernformate
Rechtsprechung & Lexikon
Aktuelle Rechtsprechungen
Services für SBV
JAV
JAV
Themen für die JAV
Seminare und Wissen für erfolgreiche JAV-Arbeit
Lernformate
Für jeden Lerntyp etwas dabei: Seminare, Fachtagungen und mehr
Schulungsanspruch
Dein Anspruch auf Fortbildungen als Jugend- und Auszubildendenvertretung
Rechtsprechung & Lexikon
Aktuelle Gerichtsurteile und wichtige Begriffe für Deine JAV-Arbeit
Services für JAV
Wir sind Ihr Bildungspartner – vor, während und nach dem Seminarbesuch!
Themen für die JAV
Lernformate
Services für JAV
Beratung
Beratung
ifb-Bildungsberatung
ifb-Bildungsberatung
ifb-Kompetenzzentren
ifb-Kompetenzzentren
Über uns
Über uns
Lernen Sie das ifb kennen
Unser ifb-Team
Von der Organisation bis zur Weiterbildung: Lernen Sie unser engagiertes Team kennen.