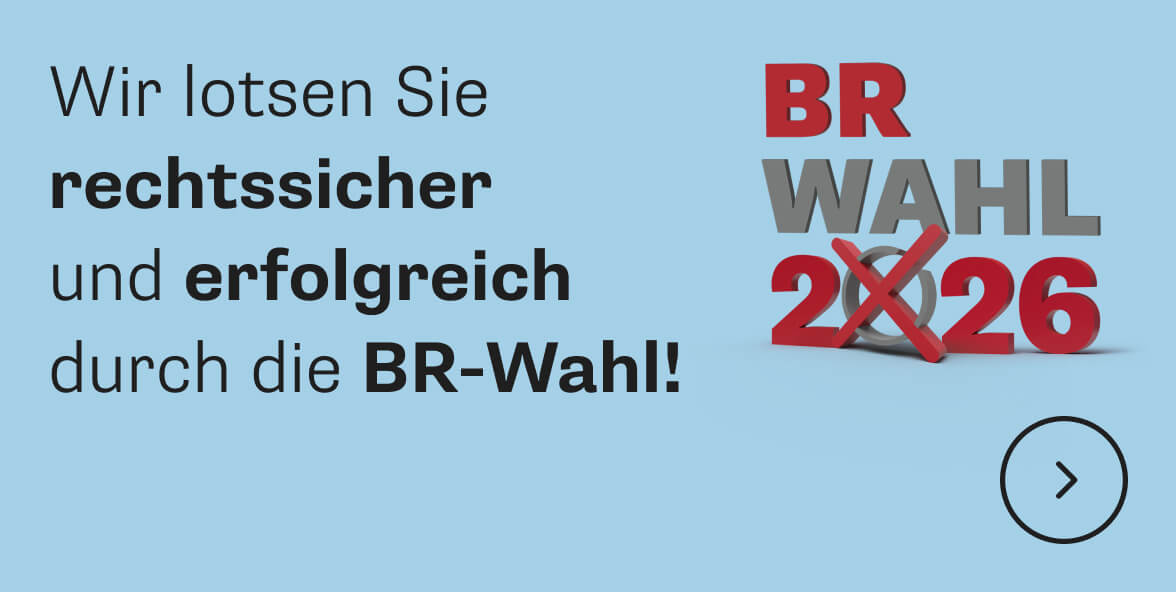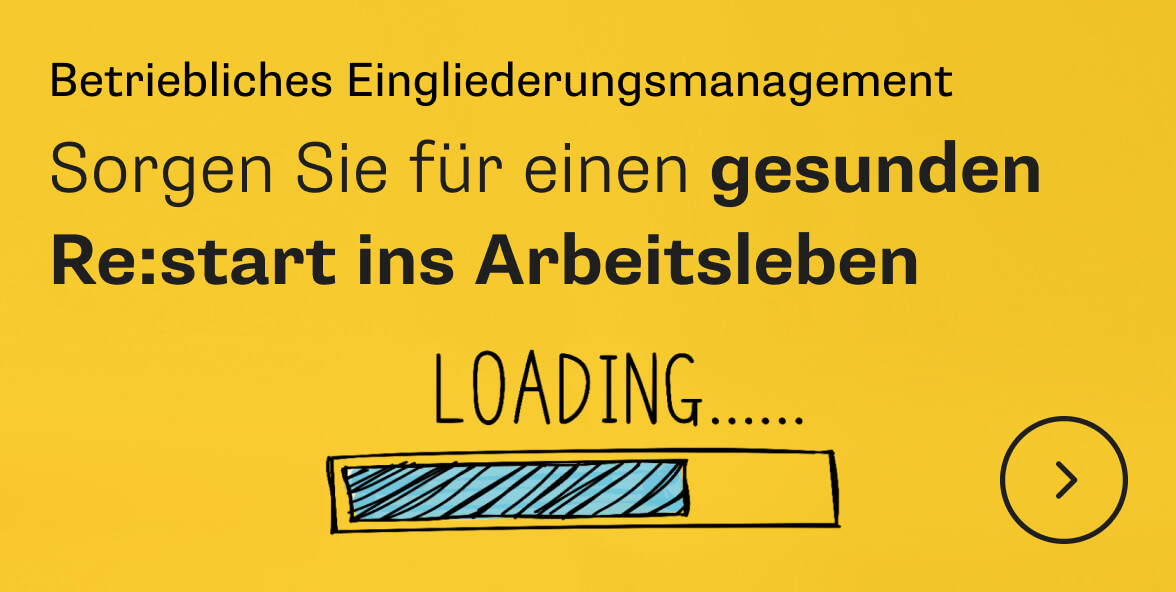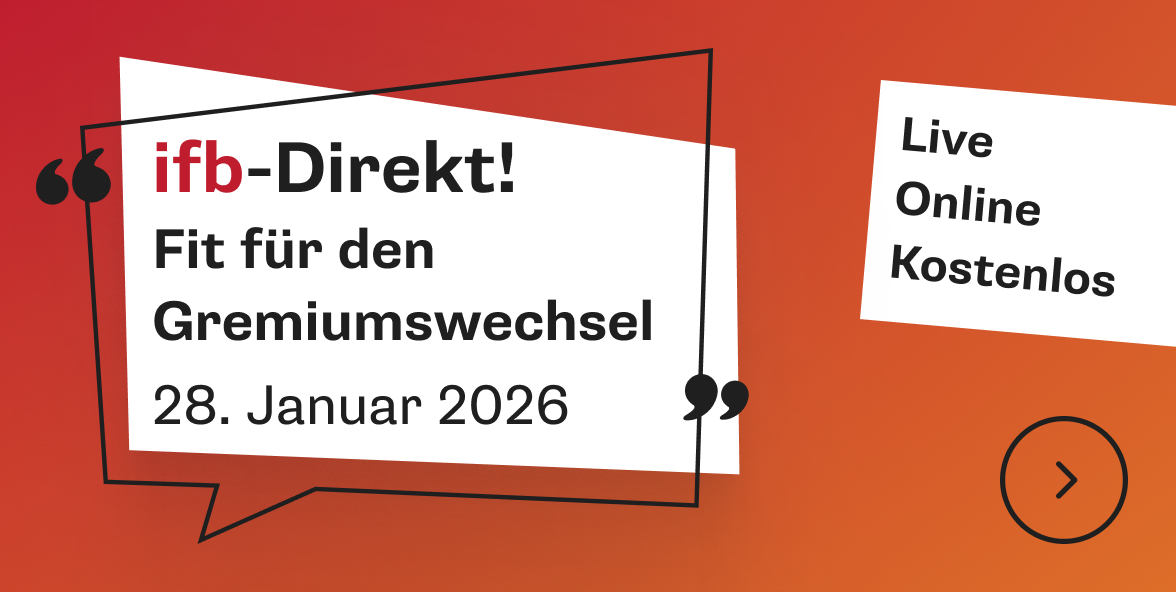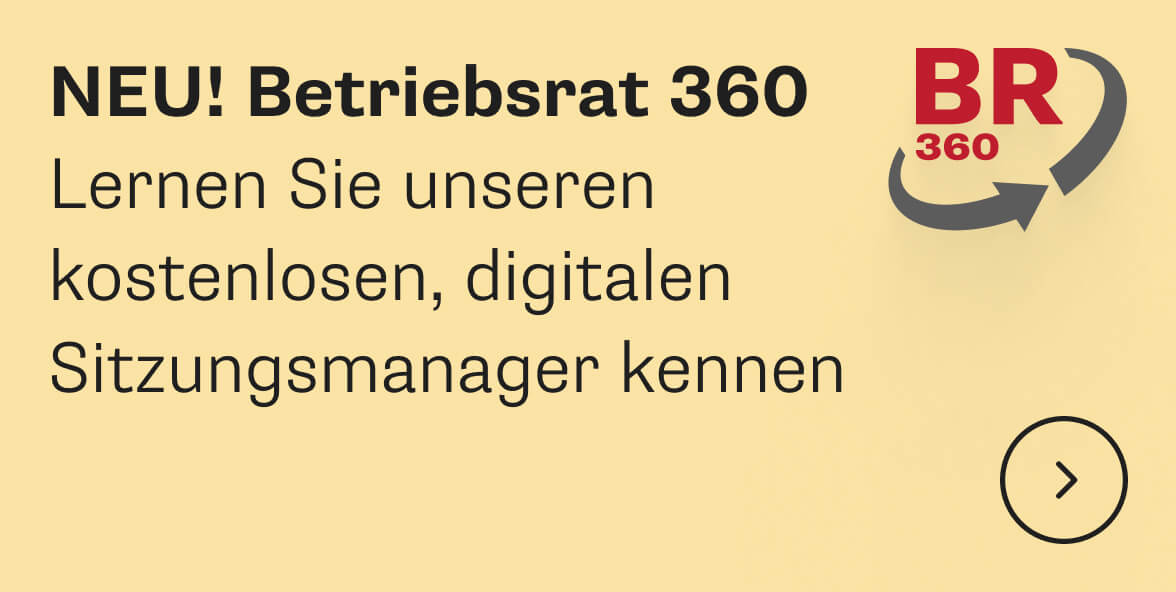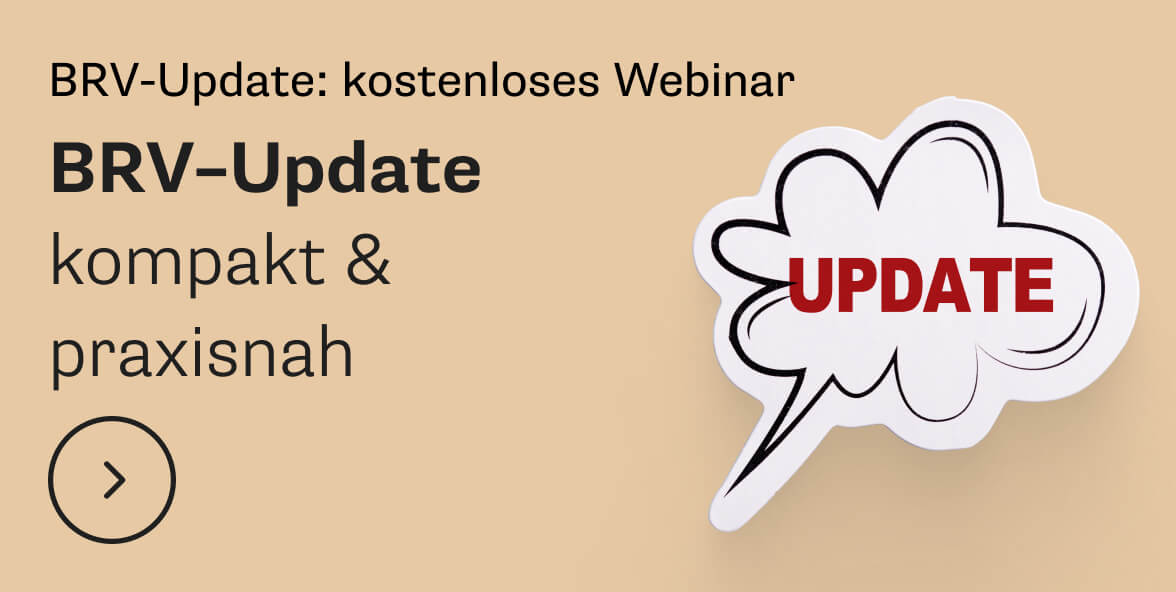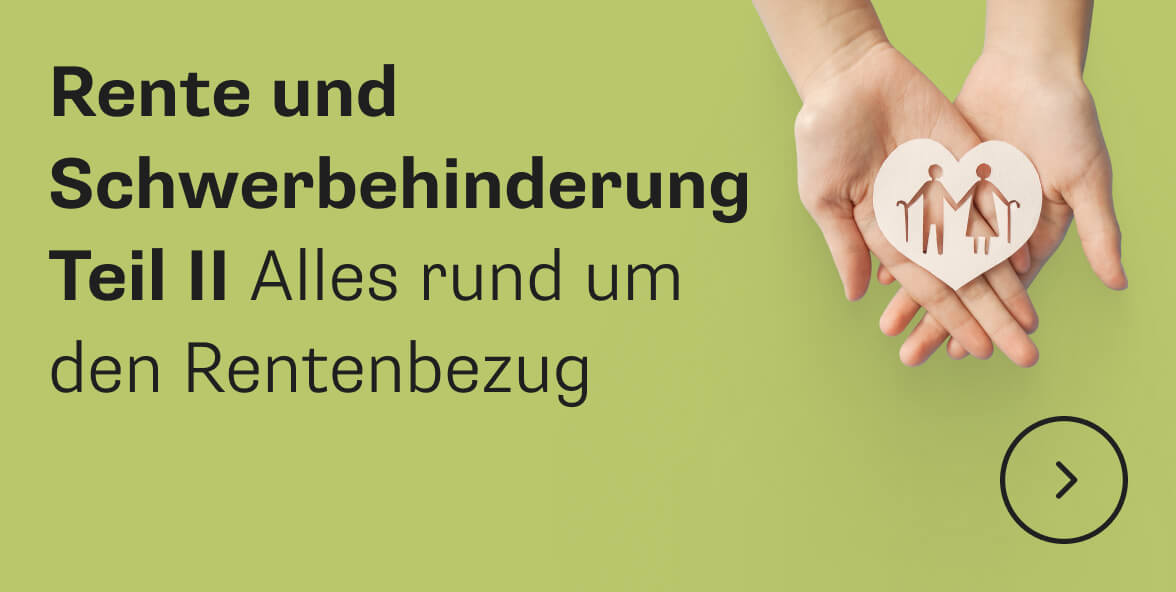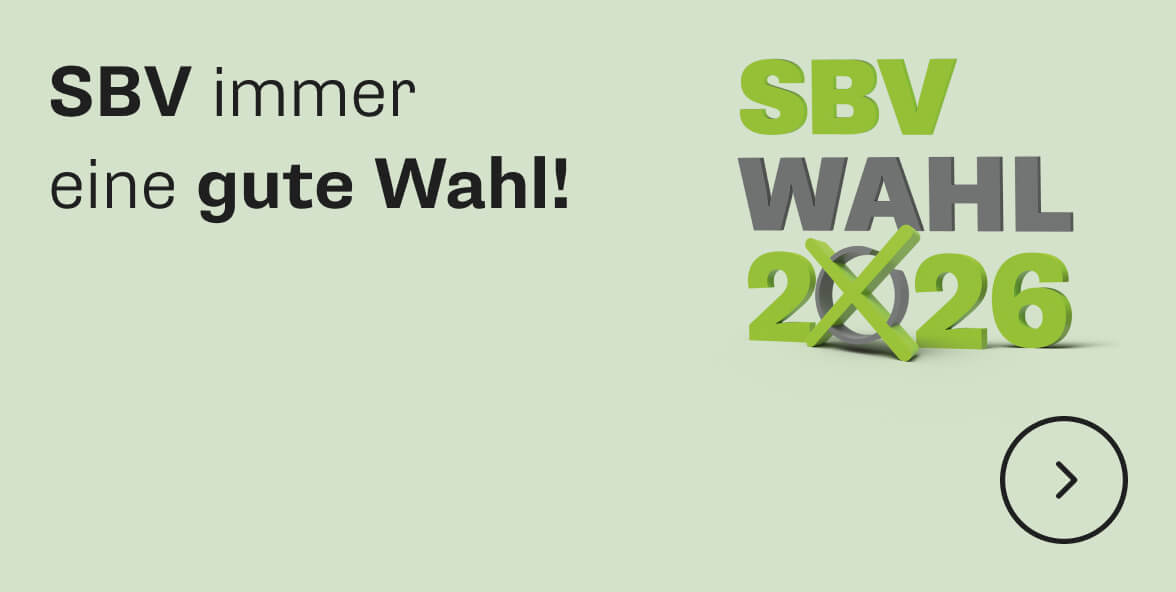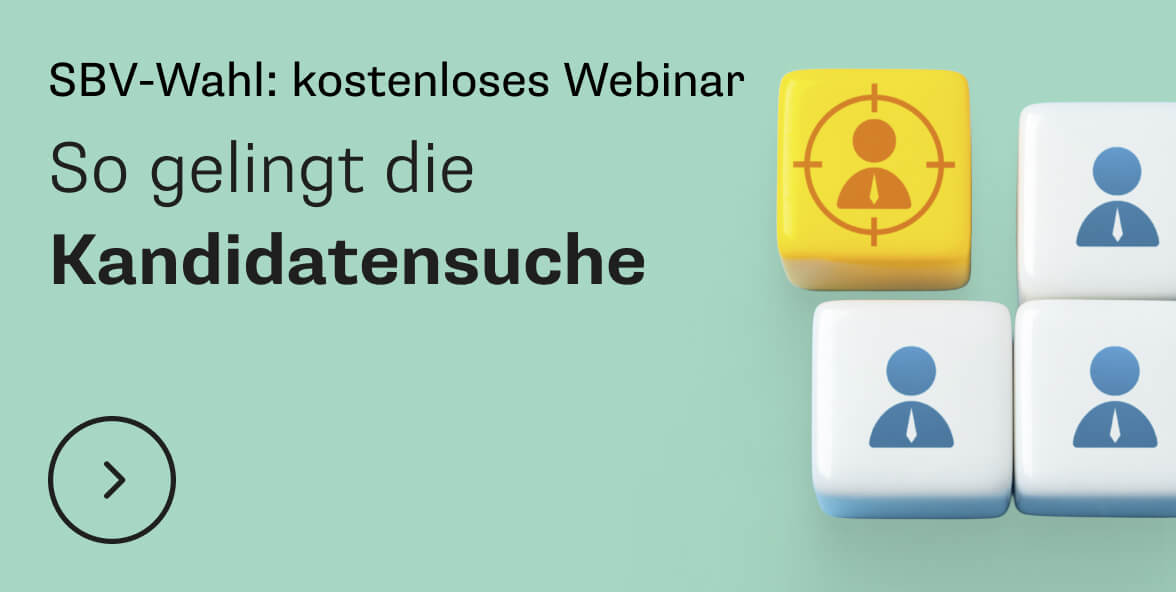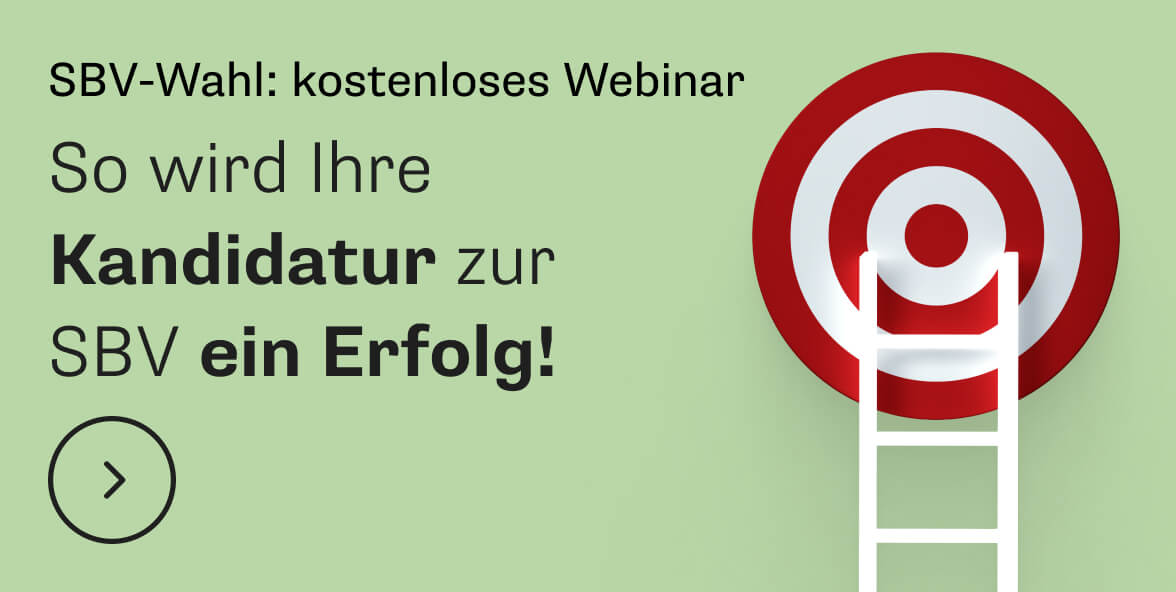So erkennen sie einen Talkoholic im Unternehmen
Talkaholics sind Vielredner, die jede Gesprächslücke als Einladung sehen. Sie fühlen sich erst wohl, wenn sie ihre Gedanken vollständig, mehrfach und in sämtlichen Varianten ausgesprochen haben.
Talkaholics neigen dazu, den Gesprächsraum überproportional einzunehmen.
Diese typischen Merkmale zeichnen sie aus:
- Hoher Redeanteil bei geringer Wahrnehmung der Gesprächssituation
Talkaholics neigen dazu, den Gesprächsraum überproportional einzunehmen. Schon die klassische Gruppenstudie von Robert F. Bales (1950) zeigte, dass Personen mit ausgeprägtem Dominanzverhalten bis zu 70 Prozent der Redezeit beanspruchen – meist ohne es zu merken. Spätere Untersuchungen bestätigten dieses Muster immer wieder.
(vgl. Bales 1950: „Interaction Process Analysis“) - Wiederholungen und Selbsterklärungen
In der Kommunikationspsychologie wird das als „Selbstvergewisserung durch Sprache“ bezeichnet: Wer sich unsicher fühlt, wiederholt Aussagen, um Zustimmung zu erzwingen oder Widerspruch zu vermeiden.
(vgl. Schulz von Thun: Selbstoffenbarungsaspekt) - Fokus auf die eigene Perspektive
Talkaholics zeigen häufig niedrige Empathie im Gesprächsverhalten, also wenig Orientierung am Gegenüber. Sie hören zwar zu, planen aber gleichzeitig schon in Gedanken ihre nächste Antwort.
(vgl. Rogers: klientenzentrierte Kommunikation) - Überzeugungs- statt Dialogmodus
Sie argumentieren weniger, um zu verstehen, sondern um zu überzeugen – ein klassisches Muster aus der argumentativen Selbstbestätigung.
(vgl. Festinger: Kognitive Dissonanztheorie) - Fehlendes Wahrnehmungsbewusstsein für Zeit und Struktur
In Gruppensettings fällt auf: Vielredner unterschätzen regelmäßig die eigene Redezeit. Dieses Verhalten hängt mit dem sogenannten „Overconfidence Bias“ zusammen – der Tendenz, das eigene Kommunikationsverhalten positiver einzuschätzen als andere.
(vgl. Kahneman & Tversky) - Starke Bedürfnisorientierung – nach Einfluss oder Anerkennung
Talkaholics kommunizieren nicht nur, um zu informieren, sondern um sich zu positionieren. Dabei bemerken sie häufig nicht, wann ihr Redefluss andere ausbremst. Während die einen den Austausch suchen, halten sie unbeirrt Monologe.
(vgl . McClelland, 1985)
Wie Sie sehen: Die Sprechdurchlauferhitzer in unserem Alltag entlarven sich rasch selbst. Erst kommt ein „Nur noch ganz kurz…“, dann dieselbe Botschaft in neuer Verpackung – und wer zwischendurch atmet, riskiert, als Diskussionsgegner wahrgenommen zu werden.
Gerade in einem BR-Gremium, wo Diskussionen ohnehin emotional und vielstimmig verlaufen, können Talkaholics schnell die Dynamik stören.
Warum Talkaholics für Betriebsräte besonders herausfordernd sind
Gerade in einem BR-Gremium, wo Diskussionen ohnehin emotional und vielstimmig verlaufen, können Talkaholics schnell die Dynamik stören. Beschlüsse verzögern sich, Tagesordnungen geraten ins Wanken, und am Ende bleibt weniger Zeit für die wirklich wichtigen Themen oder die Meinung der anderen BR-Mitglieder. Aber was tun, wenn man es sich mit der sonst ja netten Quasselstrippe nicht verderben will?
Verstehen und nicht Ausgrenzen
Ein Talkaholic meint es selten böse, wenn die Worte sprudeln wie bei einem Wasserfall. Oft steckt ein Bedürfnis nach Anerkennung, Unsicherheit oder schlicht Leidenschaft hinter dem Dauerreden. Wer das versteht, kann gelassener reagieren.
Vielleicht will der Kollege einfach sicherstellen, dass seine Sorge gehört wird? Oder er fühlt sich nur dann ernst genommen, wenn er den Raum füllt?
Praktische Tipps für Betriebsräte und Moderatoren im Umgang mit Vielrednern
- Begrenzen Sie die Redezeit: Schon in der Einladung ankündigen: „Zu jedem Punkt bitte max. 3 Minuten Redezeit pro Person.“
- Sprechreihen einführen: Zum Beispiel durch Handzeichen oder Moderationskarten.
- Aktiv zusammenfassen: „Danke, ich fasse das kurz zusammen...“ – das signalisiert Wertschätzung und stoppt elegant den Monolog.
- Gezielt andere ansprechen: Auch ruhigere Kollegen einbinden – „Frau Schulz, wie sehen Sie das?“
- Visualisierung nutzen: Ein Timer oder Redeball kann Wunder wirken – klingt kindisch, funktioniert aber erstaunlich gut.
Begegnen Sie dieser Spezies, gilt das Motto: freundlich bleiben, aber Grenzen ziehen.
Hilfe! Talkaholics auch privat?
Die Labertaschenakrobaten dieser Welt verschwinden leider auch nach Feierabend nicht – sie wechseln nur den Schauplatz. Man trifft sie im Fitnessstudio, wo sie nach jedem Satz noch einen „ganz kurzen Tipp zur richtigen Haltung“ einstreuen. Oder im Treppenhaus, wo der Weg zum Briefkasten zur halbstündigen Gesprächssession wird. Auf Familienfeiern erkennt man sie daran, dass sie die Geschichte vom letzten Sommerurlaub in drei Kapiteln und mit wörtlicher Rede erzählen – inklusive Wetterbericht.
Fazit: Begegnen Sie dieser Spezies, gilt das Motto: freundlich bleiben, aber Grenzen ziehen. Im Büro dürfen Sie das Gespräch charmant zurück auf die Arbeit lenken – privat hilft meist nur Charme, Witz und eine geschickte Exit-Strategie. (sw)