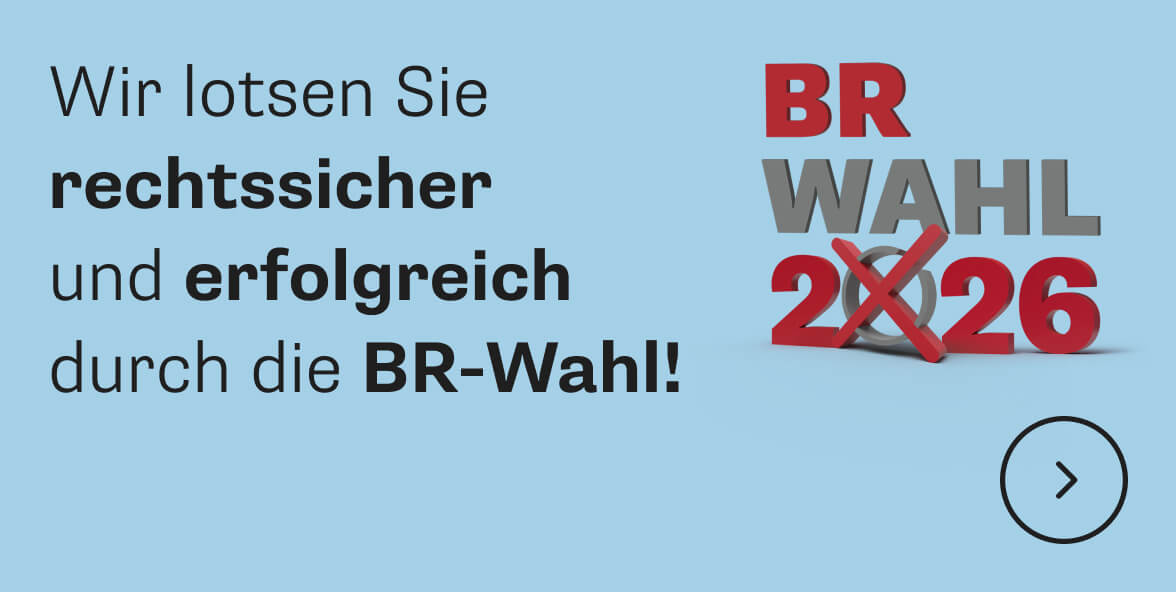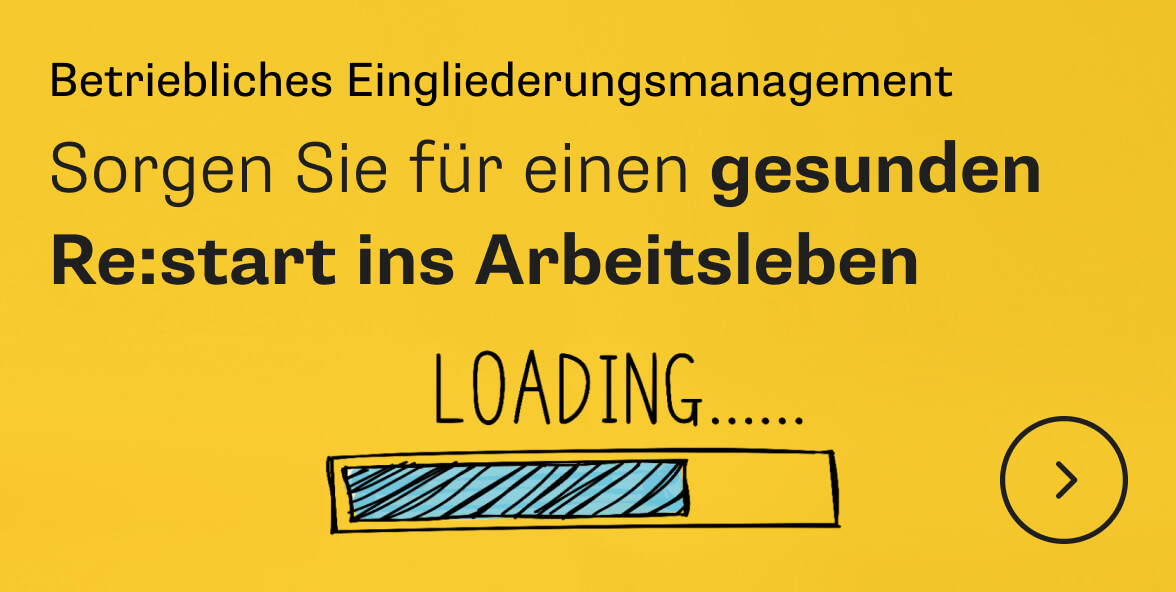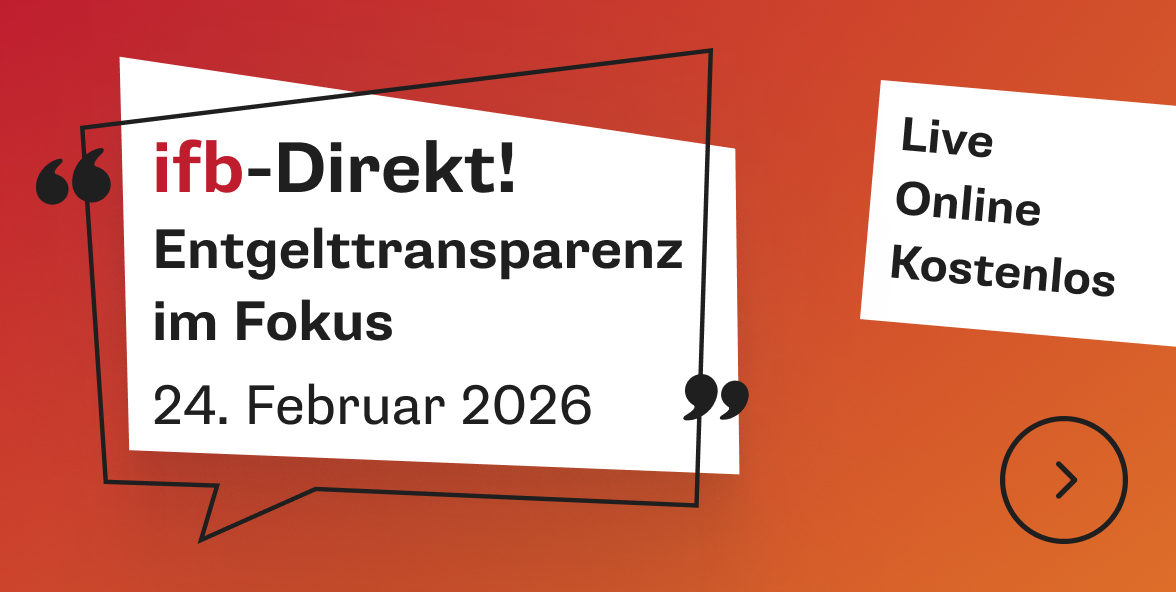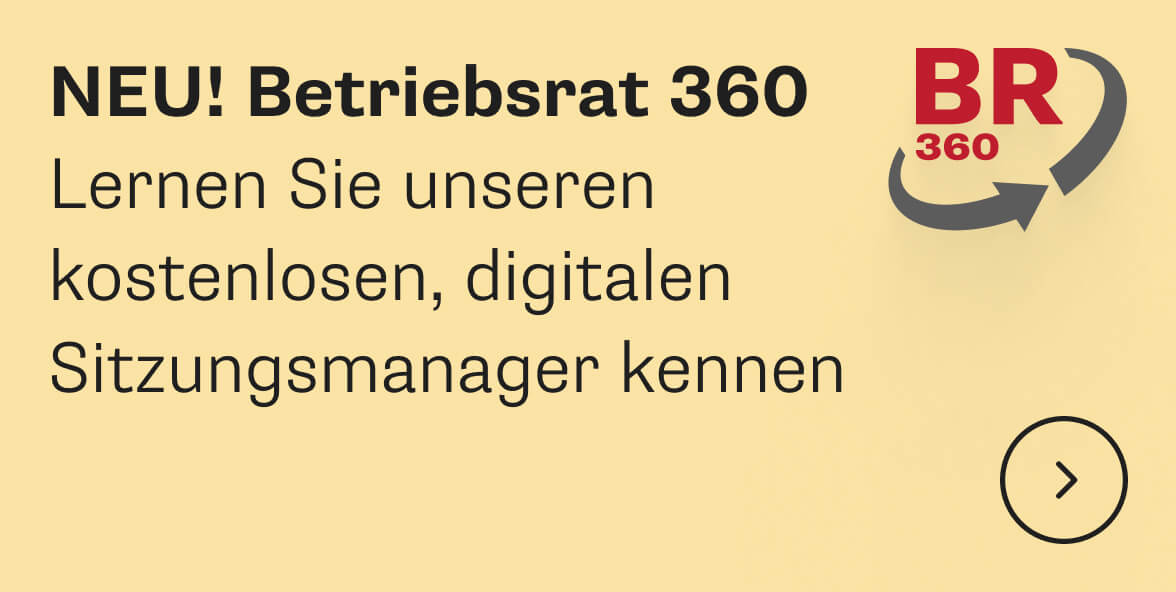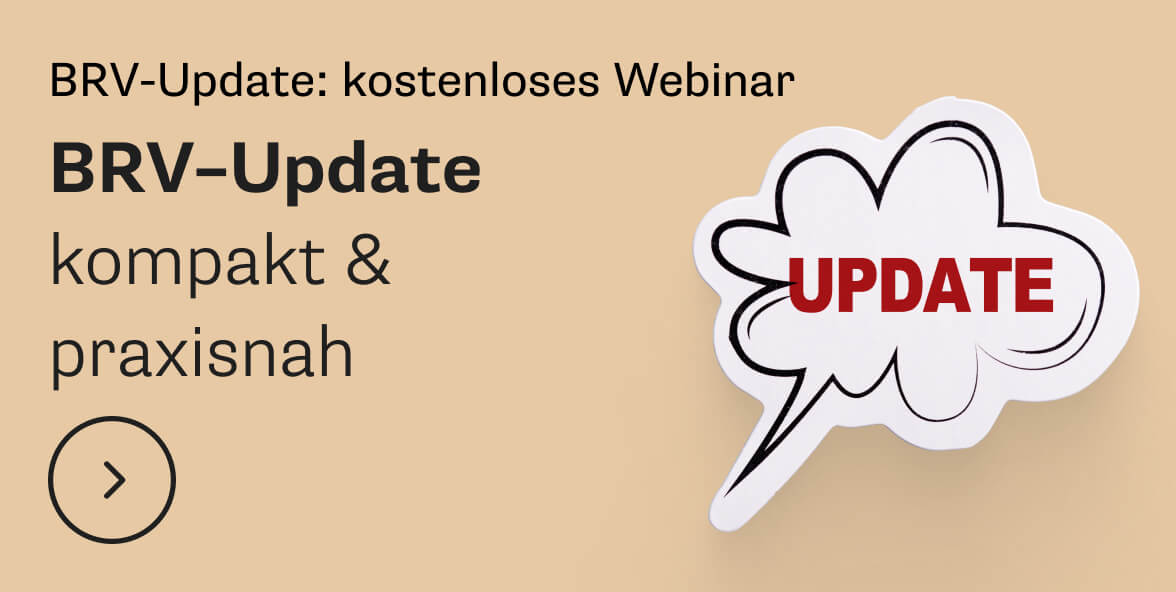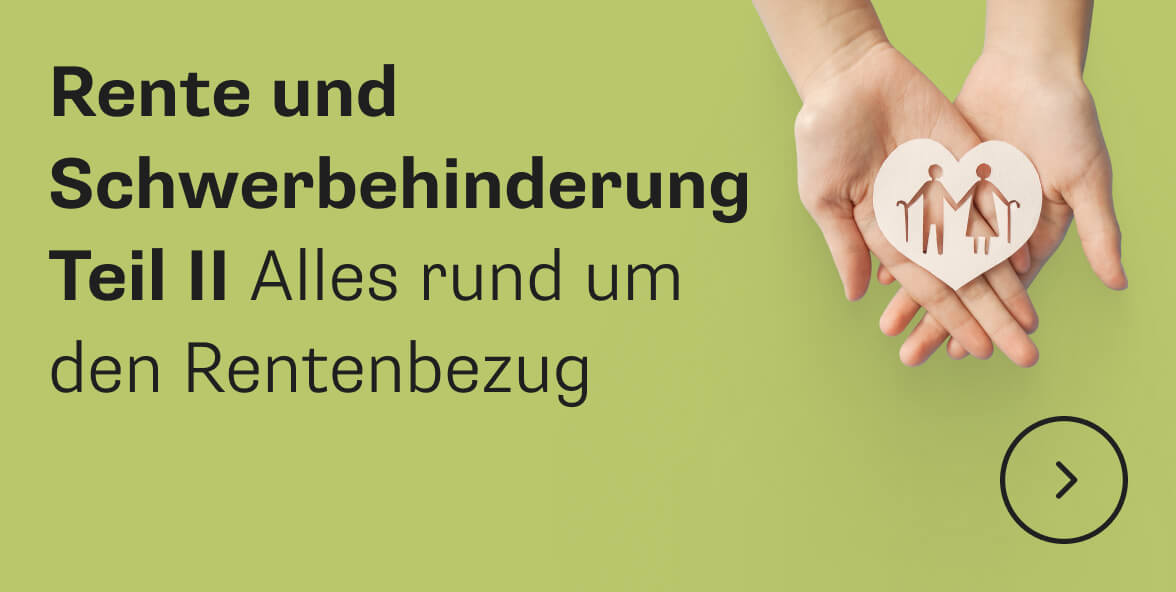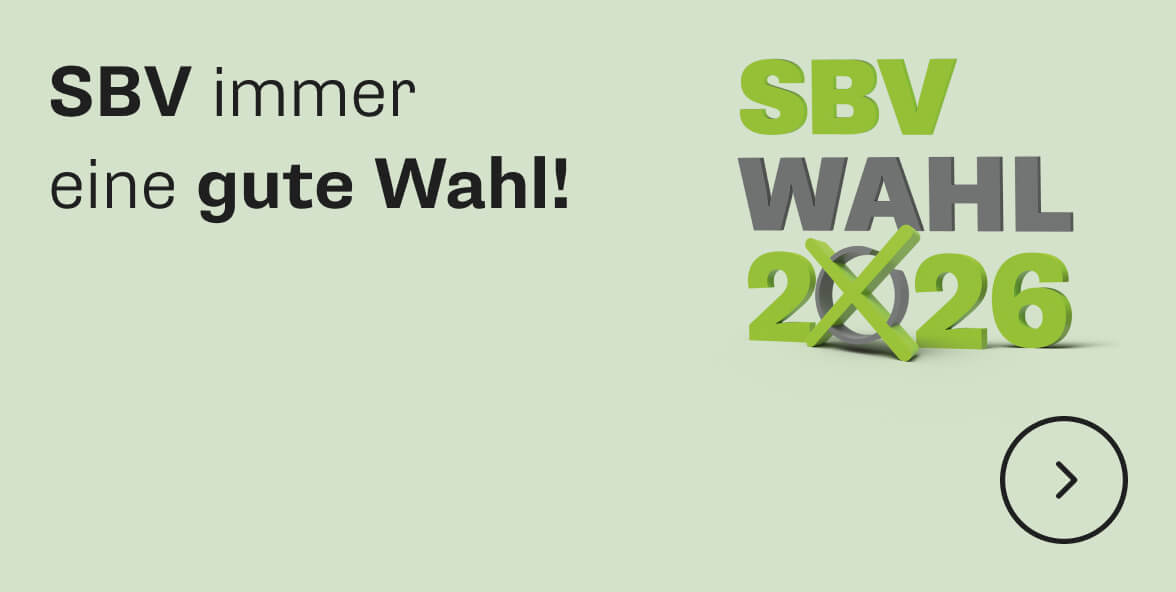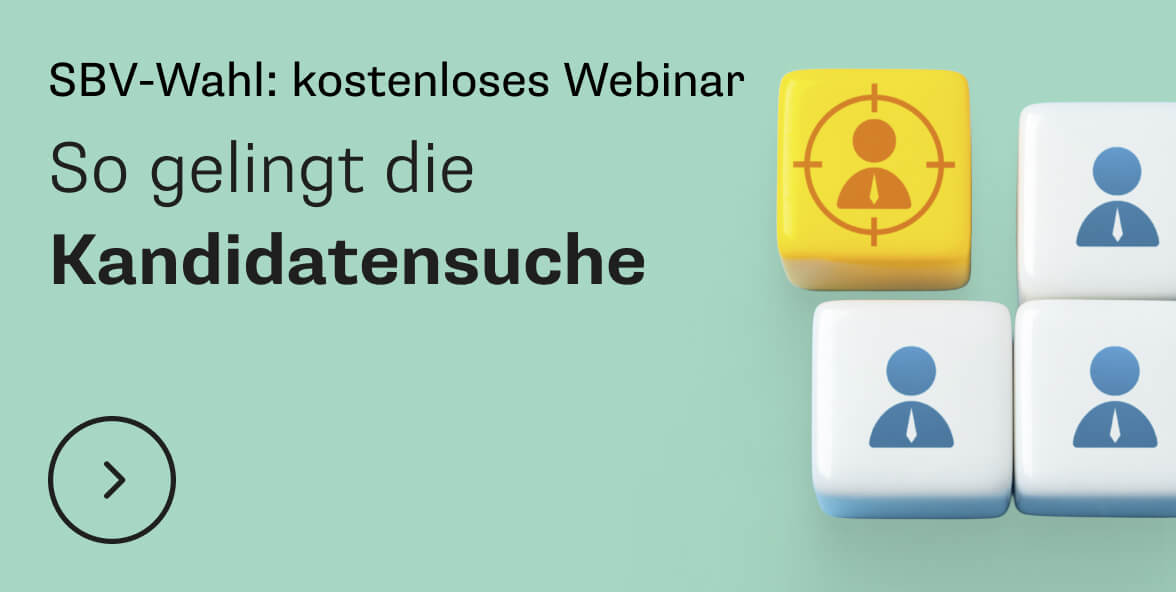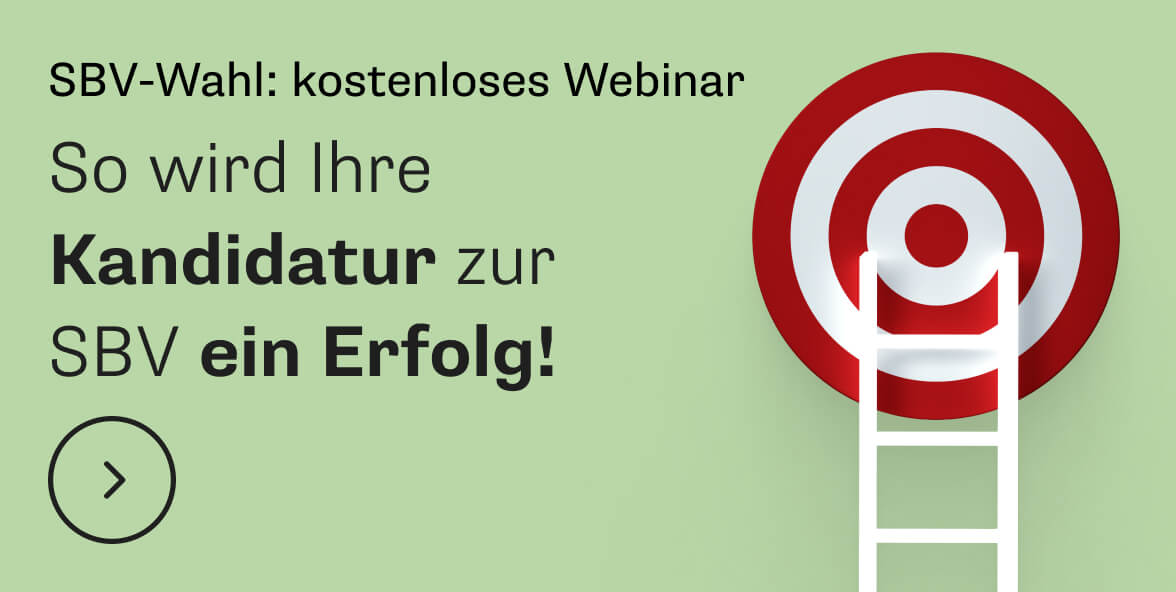Unterschiedliche Signaturen im Überblick
Hier ist wichtig zu wissen, dass es unterschiedliche Signaturen gibt. Nicht jede erfüllt die Sicherheitsanforderungen, die für eine rechtliche Verbindlichkeit ausreicht.
- Einfache elektronische Signatur (EES):
Eine EES kann in vielen Formen auftreten, wie z. B. durch das Eintippen eines Namens oder das Einfügen eines Scans einer handschriftlichen Unterschrift. Sie hat eine geringe bis gar keine rechtliche Verbindlichkeit und kann leicht angefochten werden.
- Fortgeschrittene elektronische Signatur (FES):
Fortgeschrittene elektronische Signaturen basieren auf einem einmaligen, geheimen Schlüssel, der vom Signaturhersteller zusammen mit der mit der Signatur verknüpften Person erstellt wurde. Für die FES gibt es gesetzliche Festlegungen (z.B. in der eIDAS-VO und dem Vertrauensdienstegesetz). Werden Dokumente mit einer FES signiert, kann festgestellt werden, von wem es signiert und ob es verändert wurde. Grundsätzlich kann mit einer fortgeschrittenen Signatur wirksam ein Vertrag abgeschlossen werden. Ein Ersatz der gesetzlich vorgeschriebenen Schriftform ist mit ihr nicht möglich.
- Qualifizierte elektronische Signatur (QES):
Eine qualifizierte elektronische Signatur ist die höchste Stufe der elektronischen Signatur und muss von einem „qualifizierten Vertrauensdiensteanbieter“ erstellt werden. Sie hat die gleiche rechtliche Wirkung wie eine handschriftliche Unterschrift und ist in der EU und anderen Rechtsordnungen als solche anerkannt.
Wichtig: Mit einer qualifizierten elektronischen Signatur kann die gesetzlich vorgeschriebene Schriftform ersetzt werden, § 126a BGB. Somit ist mit ihr auch digitale BR-Arbeit möglich.
Wie kommt man an eine qualifizierte elektronische Signatur?
Die gute Nachricht ist: Jeder Arbeitnehmer besitzt eine Signaturkarte – und zwar den amtlichen Personalausweis oder den amtlichen Aufenthaltstitel. Beide Ausweisdokumente beinhalten einen sogenannten Fernsignatur, mit der es möglich ist, eine qualifizierte elektronische Signatur zu erstellen.
Wichtig: Um die elektronischen Fähigkeiten des Ausweises nutzen zu können, muss man eine PIN (Persönliche IdentifikationsNummer) beim zuständigen Einwohnermeldeamt beantragen. Eine Alternative dazu ist eine Signaturkarte (Hardware), die man sich bei verschiedensten Diensteanbietern erstellen lassen kann.
Das ist der erste Schritt. Für die Umsetzung im Betrieb braucht man aber noch mehr, und zwar:
- einen handelsüblichen Kartenleser (z. B. von Reinert SCT, Kobil u. ä.)
- ein NFC-fähiges Smartphone
- die AusweisApp2 für das Smartphone (gibt es kostenlos im Appstore bei Google und Apple)
- eine (kostenpflichte) Signatursoftware für den Computer
Wie „unterschreibt“ man dann in der Praxis?
Beispiel Protokoll der letzten BR-Sitzung: In § 34 Abs. 1 S. 3 BetrVG ist die elektronische Form nicht ausgeschlossen – sämtliche durch den Betriebsrat erstellten Dokumente können somit in elektronischer Form erstellt und qualifiziert elektronisch signiert werden.
Die qualifizierte elektronische Signatur erfolgt vom Betriebsratsvorsitzenden unter der Nutzung von Smartphone und dem Personalausweis oder mittels des Kartenlesers. Das Protokoll des Betriebsrats ist somit durch den Betriebsratsvorsitzenden unterzeichnet worden. Er kann dann dieses qualifiziert elektronische Dokument an ein weiteres Betriebsratsmitglied senden, damit dieses ebenfalls das Protokoll qualifiziert elektronisch unterschreibt. Hierdurch ist gesichert, dass die Dokumente fälschungssicher elektronisch gespeichert und archiviert werden können. Dadurch ist eine volldigitale Arbeitsweise des Betriebsrats ohne Medienbrüche möglich.
Laden Sie sich jetzt weitere Informationen zum Thema herunter: