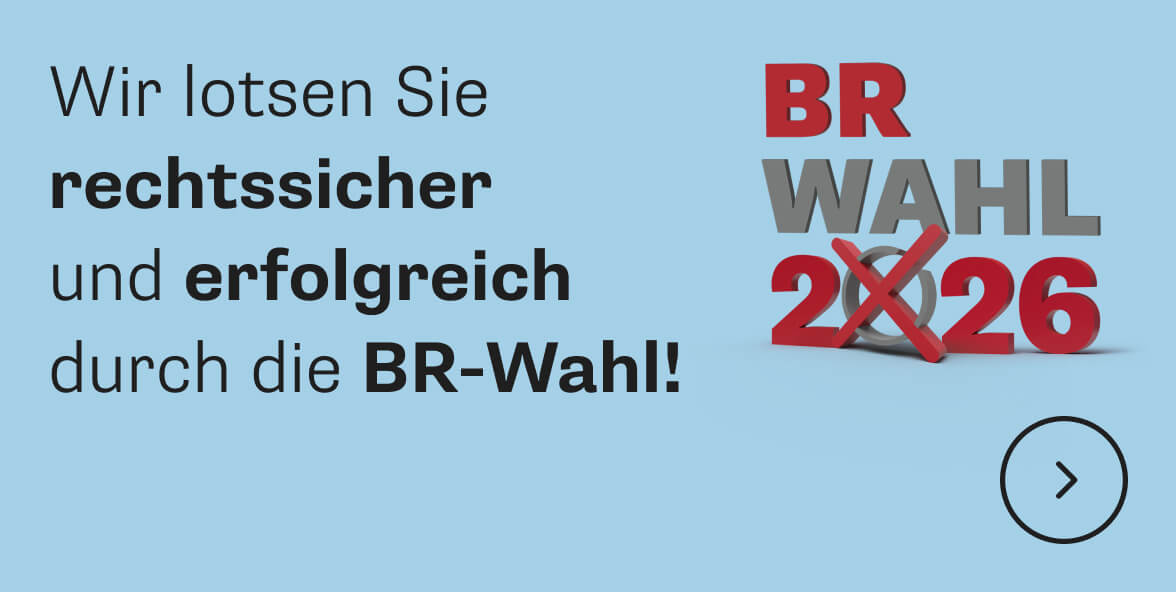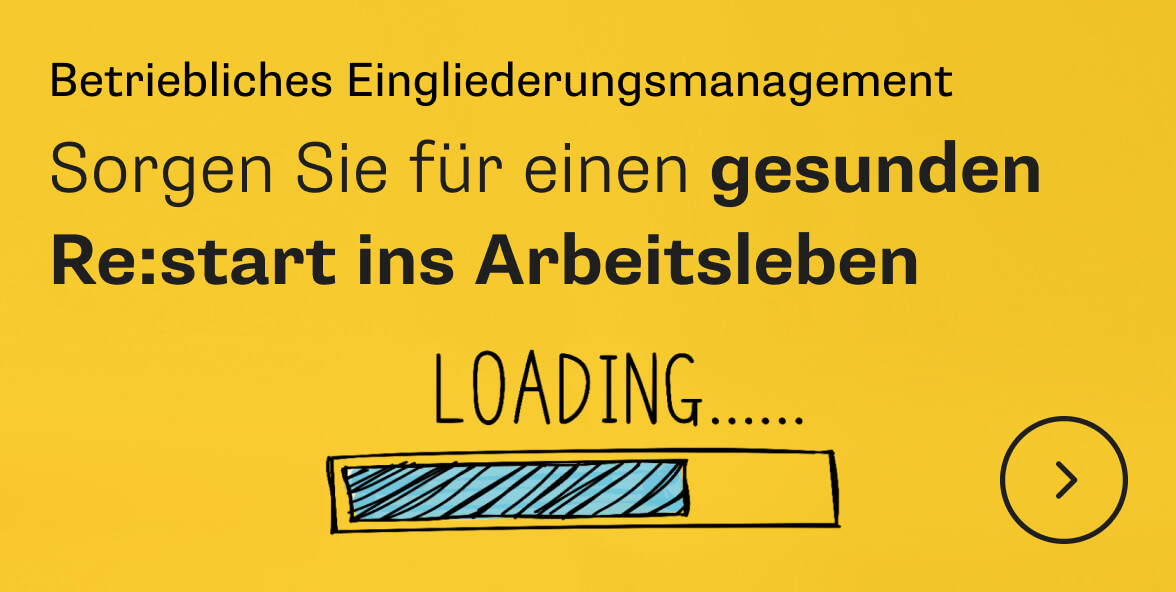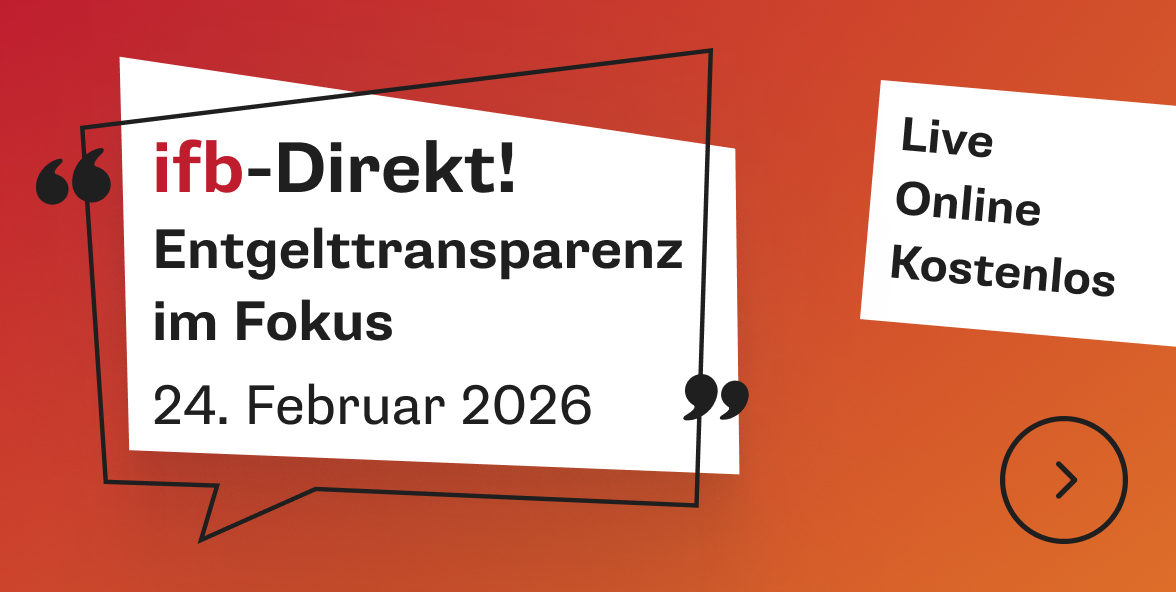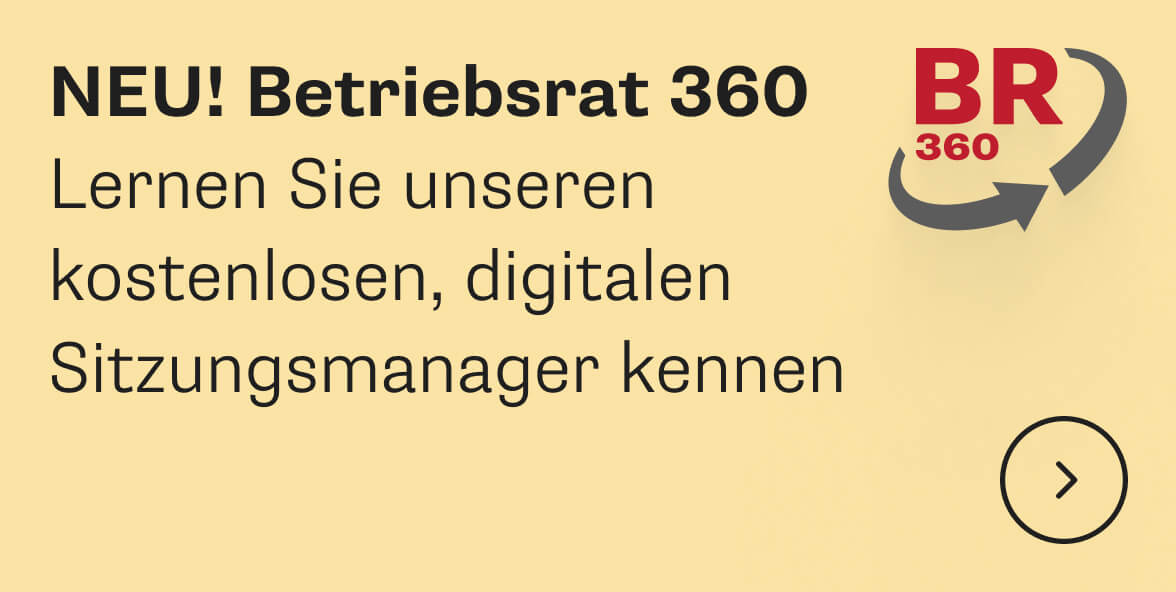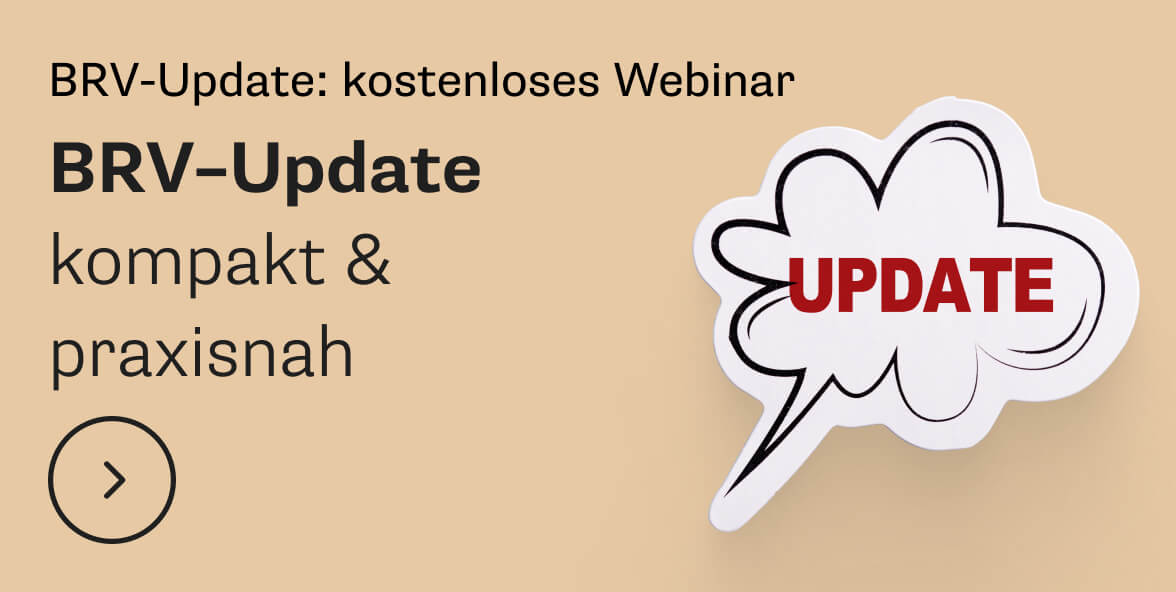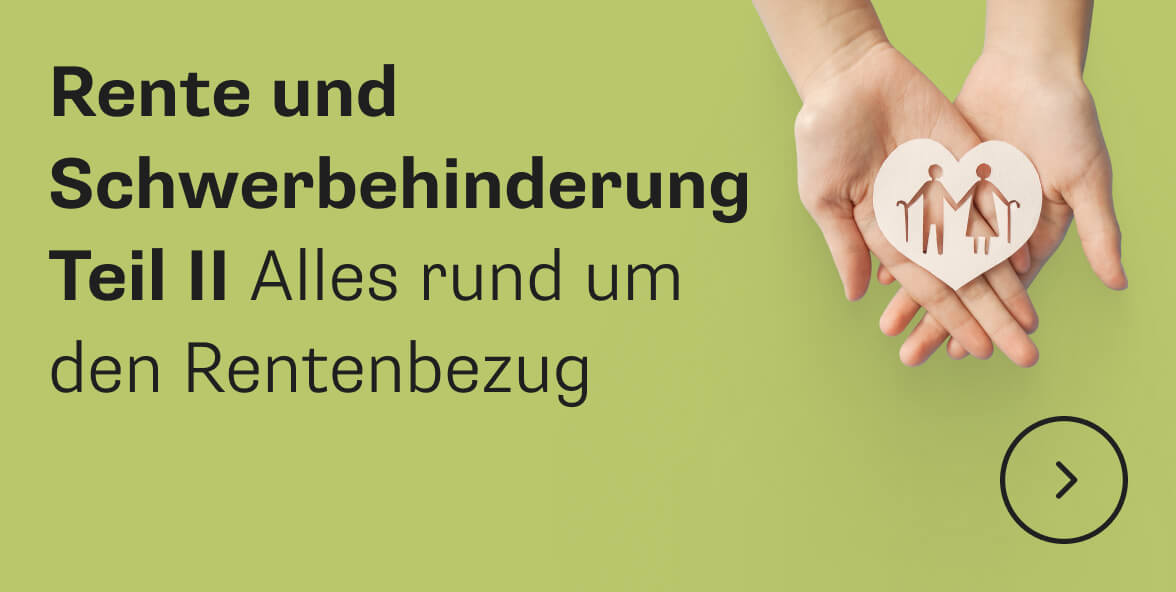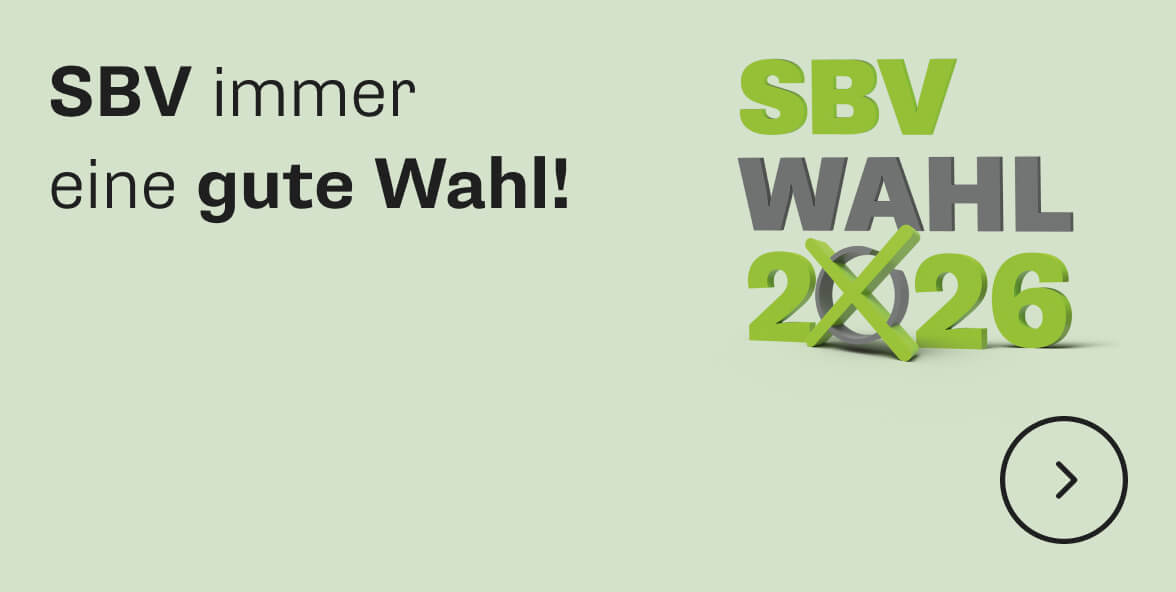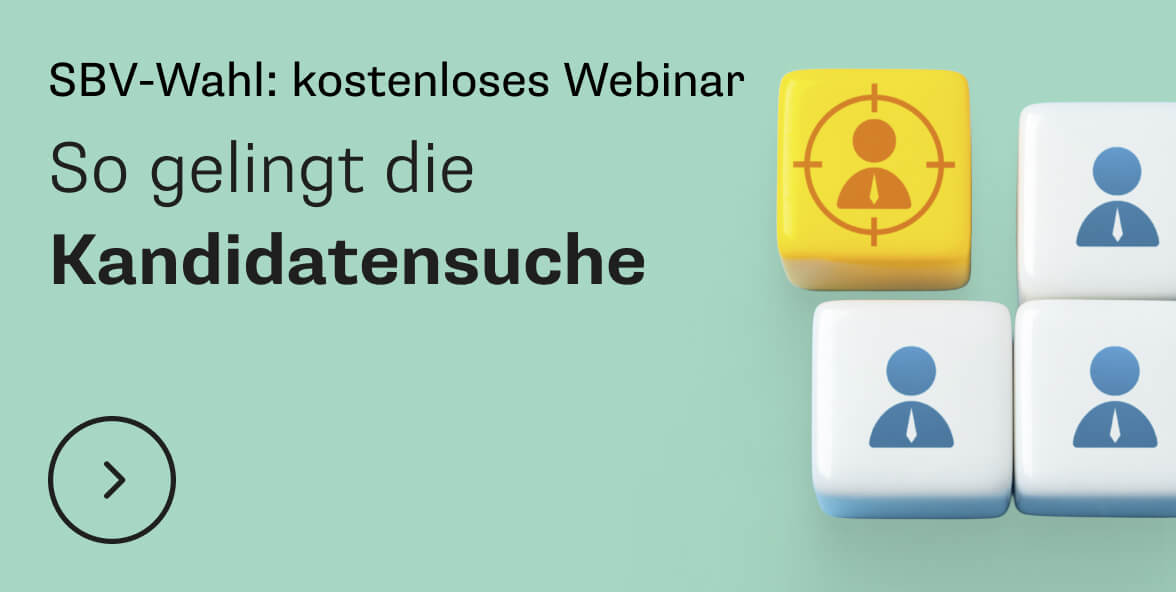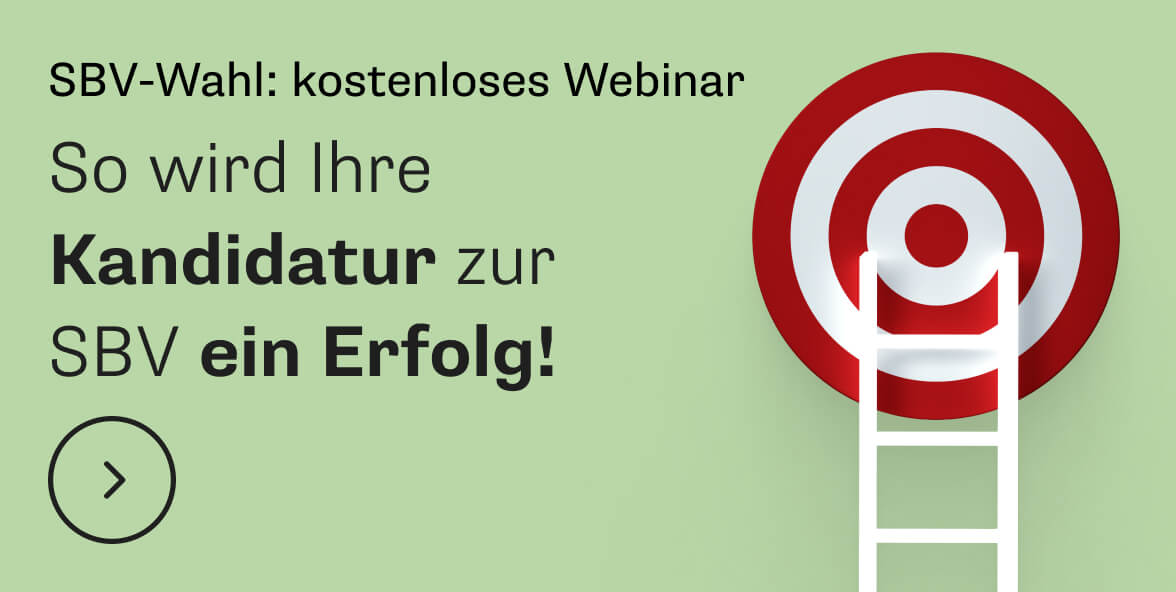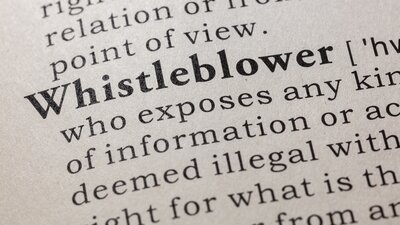Was ist Gig-Work eigentlich?
„Gig“ – das ist doch ein kurzer Musikauftritt in der nächsten Kneipe? Richtig! Aber übertragen auf die Arbeitswelt bedeutet Gig-Work: kurzfristige Aufträge, die meist über digitale Arbeitsplattformen vergeben werden. Anstelle eines festen Arbeitsvertrags übernehmen die Beschäftigten einzelne Aufgaben – etwa Essenslieferungen, Fahrten, Reparaturen oder Online-Dienstleistungen wie Übersetzungen oder Softwaretests. Bezahlt wird pro Auftrag.
Auf den ersten Blick klingt das flexibel und modern: Arbeiten, wann und wie man möchte. Wer wünscht sich das nicht? Doch die Realität sieht oft anders aus. Wer auf Gig-Work angewiesen ist, erlebt schwankende Einkommen, fehlende Planbarkeit und kaum soziale Absicherung. Und das sind nicht wenige. Laut EU-Kommission waren 2022 rund 28 Millionen Menschen in Europa in der Plattformarbeit tätig – Ende 2025 könnten es sogar 43 Millionen sein. Ein Trend mit Auswirkungen auf die Beschäftigten!
Formen und Branchen von Gig-Work gibt es in Deutschland
Hier ein paar Beispiele:
- Lieferdienste: Essenszustellung (z. B. Lieferando, Wolt, Uber Eats) – die sichtbarste Form von Gig-Arbeit.
- Mobilität: Fahrer bei Uber oder Free Now.
- Crowdworking: Plattformen wie Clickworker, AppJobber, die digitale Kleinstaufträge vergeben (Texte, Übersetzungen, App-Tests).
- Dienstleistungen im Alltag: Reinigungs- oder Handwerker-Plattformen, Pflege- und Haushaltshilfen.
- Kreativ- und IT-Bereich: Design, Programmierung oder Übersetzung über Plattformen wie Fiverr, Upwork oder Malt.
- Nachhilfe-Plattformen wie Superprof, Preply, GoStudent – hier arbeiten viele Menschen auf Abruf.
Plattformen geben sich gern als reine Vermittler aus.
Plattformanbieter: Arbeitgeber oder doch nur Vermittler?
Plattformen geben sich gern als reine Vermittler aus. Sie bringen Kunden und Dienstleister zusammen und behaupten, selbst kein Arbeitgeber zu sein. In der Praxis aber bestimmen doch viele Plattformen über Preise, Aufträge und Bewertungen – also über zentrale Arbeitsbedingungen. Die Grenze zwischen neutralem Marktplatz und faktischem Arbeitgeber verschwimmt dadurch immer mehr und landet dann auch schon mal vor Gericht.
Das BAG-Urteil zum Crowdworking
Im Jahr 2020 entschied das Bundesarbeitsgericht, dass ein Crowdworker im Einzelfall ein Arbeitnehmer sein kann (9 AZR 102/20). Der Kläger hatte über eine Plattform regelmäßig Mikrojobs übernommen – etwa die Kontrolle von Produktpräsentationen in Tankstellen und Geschäften. Obwohl er theoretisch frei wählen konnte, welche Aufträge er annimmt, war er durch enge Vorgaben, kurze Fristen und ein Punktesystem stark an die Plattform gebunden.
Als die Plattform den Vertrag kündigte, erhob der Crowdworker Kündigungsschutzklage und wollte feststellen lassen, dass ein Arbeitsverhältnis bestand. Das BAG gab ihm Recht: Seine Tätigkeit war weisungsgebunden und fremdbestimmt – damit lagen die typischen Merkmale eines Arbeitsverhältnisses nach § 611a BGB vor.
Wichtig ist jedoch: Das Gericht hat keine generelle Regel für alle Crowdworker geschaffen. Es betonte ausdrücklich, dass es eine Einzelfallentscheidung war.
Wer sich auf Plattformarbeit einlässt, sollte vorher genau prüfen, was ihn erwartet.
Arbeitsbedingungen, rechtlicher Status und soziale Folgen
Wer sich auf Plattformarbeit einlässt, sollte vorher genau prüfen, was ihn erwartet. Im ersten Moment klingt „Flexibilität und Freiheit“ im Job sehr reizvoll, ist aber bei genauerem Hinschauen oft nur Schein. Obwohl viele Gig-Worker offiziell als selbstständig gelten, sind sie trotzdem stark von einer Plattform abhängig. In der Praxis entsteht dadurch häufig eine Grauzone zwischen – Unternehmer oder doch scheinselbstständiger, abhängiger Arbeitnehmer. Das bedeutet: Rechte für Arbeitnehmer wie Urlaub, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall oder Kündigungsschutz greifen grundsätzlich nicht.
Weitere Nachteile: Nicht die Menschen selbst bestimmen, wann und wie sie arbeiten – sondern unsichtbare Algorithmen. Die verteilen Aufträge, werten Leistungen aus und entscheiden darüber, wer wie viele Jobs bekommt. Eine einzige schlechte Bewertung kann schnell das Einkommen verringern.
Das Ergebnis sind oft prekäre Verhältnisse: schwankende Einkommen, fehlende Planbarkeit und keinerlei soziale Absicherung. Laut einer aktuellen IAB-Studie verdienten Lieferdienstfahrer im Schnitt nur rund 1.700 Euro brutto im Monat – etwa 800 Euro weniger als Beschäftigte in vergleichbaren Berufen.
Typische Probleme von Gig-Work auf einem Blick:
- Fehlender Urlaub, Lohnfortzahlung oder Mindestlohn.
- Bezahlung pro Auftrag – Wartezeiten und Ausfälle sind unbezahlt.
- Algorithmen steuern die Auftragsvergabe, schlechte Bewertungen bedeuten weniger Jobs.
- Hoher Leistungsdruck: z. B. Radkuriere unter Zeitdruck. Die Folge sind Unfall- und Gesundheitsrisiken.
- Unregelmäßiges Einkommen, oft unterhalb des Mindestlohns.
- Mangelnde Absicherung bei Krankheit, Arbeitslosigkeit oder fürs Alter.
- Keine Vereinbarkeit von Arbeit und Familie, da Aufträge kurzfristig vergeben werden.
Gig-Work verstärkt bestehende Ungleichheiten. Algorithmen bevorzugen ständige Verfügbarkeit.
Diskriminierung und Ungleichheiten – warum Frauen besonders betroffen sind
Wo Punkte nur für Tempo und Dauerpräsenz vergeben werden, ist absehbar, wer verliert: Wer Kinder betreut, hat schlechtere Karten – meist trifft das die Frauen. Und tatsächlich: Gig-Work verstärkt bestehende Ungleichheiten. Algorithmen bevorzugen ständige Verfügbarkeit. Frauen landen zudem häufiger in schlechter bezahlten „Care-Gigs“, während Männer eher besser vergütete Technikjobs übernehmen.
Handlungsmöglichkeiten für Betriebsräte und Beschäftigte
Betriebsräte haben auch beim Thema Gig-Work einen gewissen Handlungsspielraum. Wichtig ist zunächst ein genauer Blick in den eigenen Betrieb: Wo werden Aufträge ausgelagert oder Plattformarbeiter eingesetzt? Über Betriebsvereinbarungen lassen sich z.B. Mindeststandards und Informationspflichten festschreiben. Und auch wenn Plattformbeschäftigte oft formal selbstständig sind, sollte der Betriebsrat mögliche Scheinselbstständigkeit prüfen und Betroffene auf Beratungsangebote hinweisen. Unterstützung bieten hier Gewerkschaften sowie Initiativen wie „Fairwork“ oder die Hans-Böckler-Stiftung.
Fazit: Trend und mögliche Veränderungen
Gig-Work ist längst keine Randerscheinung mehr, sondern prägt zunehmend unseren Arbeitsmarkt. Mit der EU-Richtlinie zur Plattformarbeit, die am 1. Dezember 2024 in Kraft getreten ist, kommt nun Bewegung in die Debatte: Künftig sollen Beschäftigte digitaler Plattformen leichter als Arbeitnehmer anerkannt werden und mehr Schutzrechte erhalten. Die Mitgliedstaaten – also auch Deutschland – müssen die Vorgaben bis Ende 2026 umsetzen.
Damit wächst auch der Druck auf die Plattformen, ihre Algorithmensysteme transparenter zu gestalten und faire Arbeitsbedingungen sicherzustellen. Gewerkschaften wie ver.di und IG Metall begleiten diesen Prozess bereits und organisieren die Beschäftigten. Der Trend zeigt: Plattformarbeit wird bleiben – und die kommenden Jahre bieten die Chance, aus reiner Flexibilität endlich faire Arbeit mit Sicherheit und guter Bezahlung für die vielen Gig-Worker zu machen. (sw)