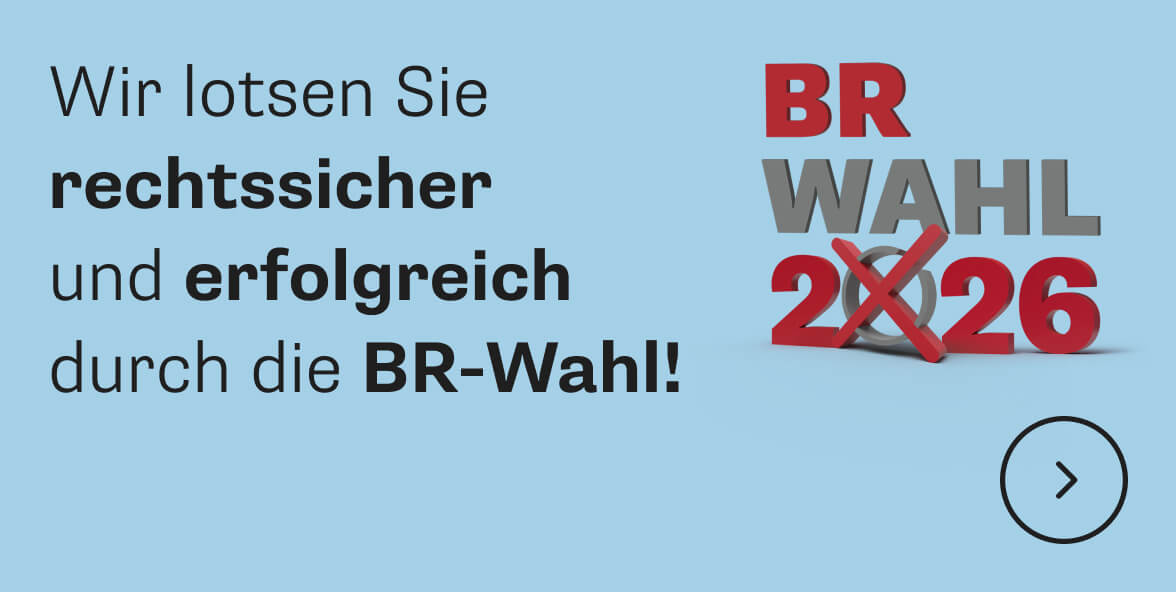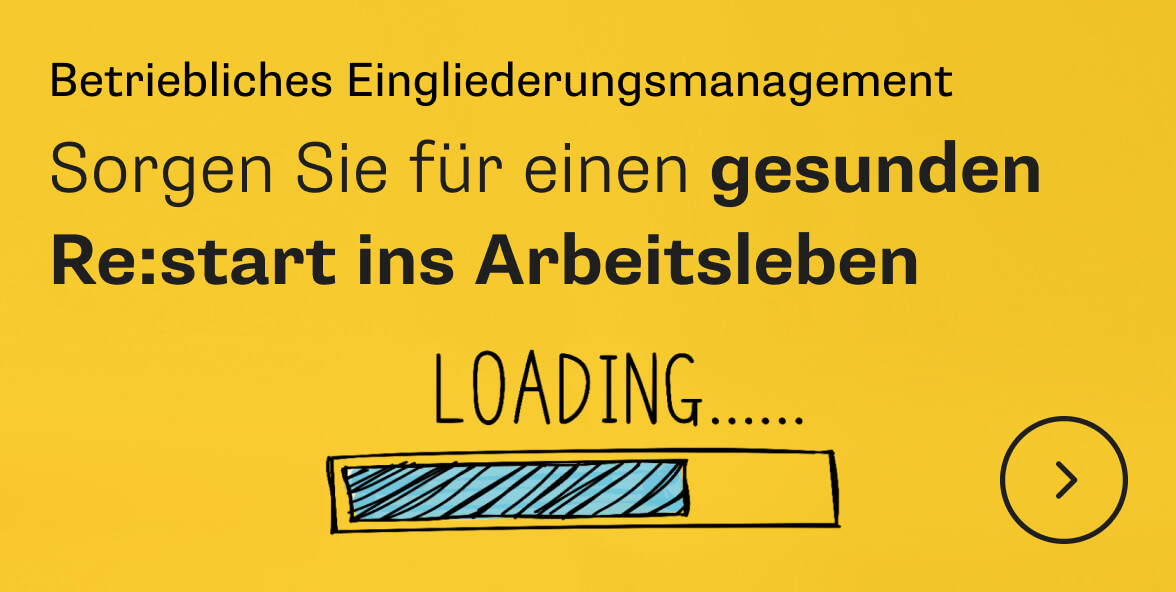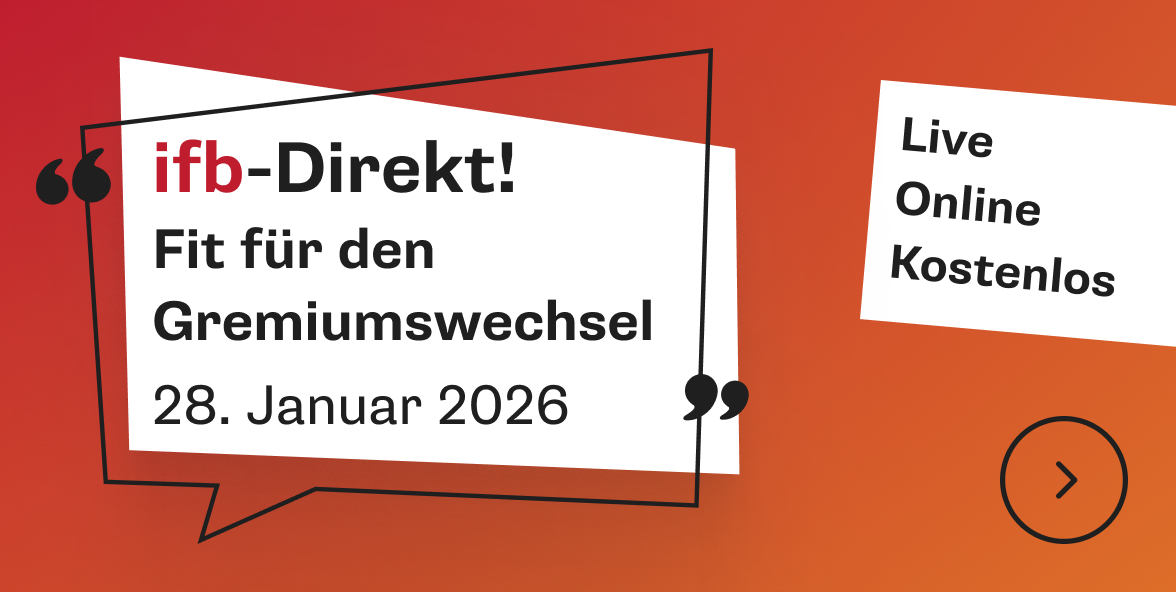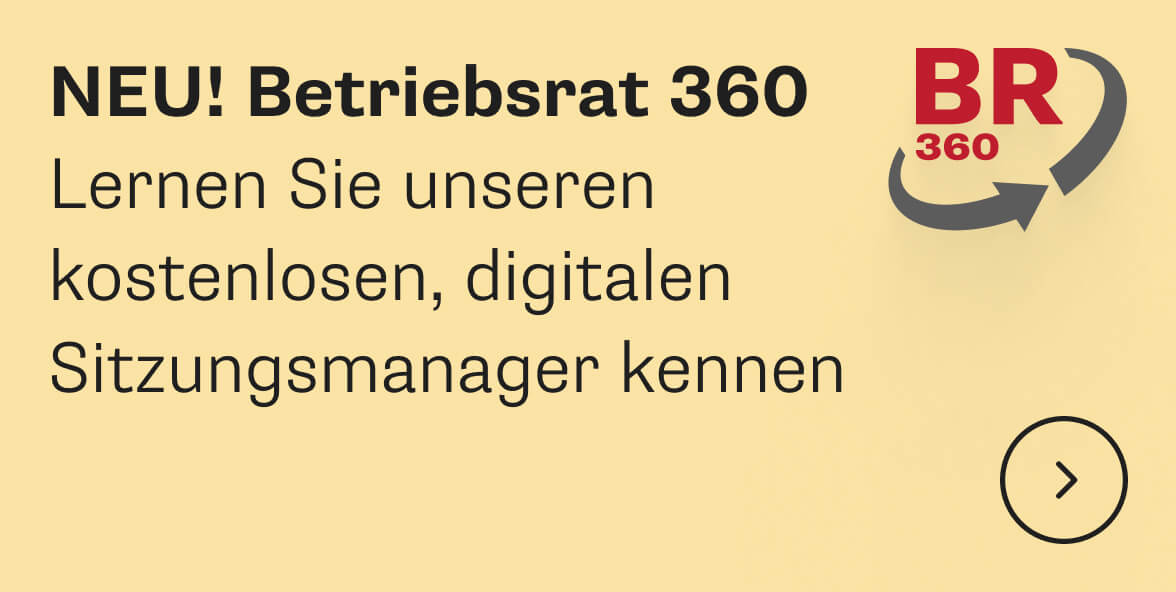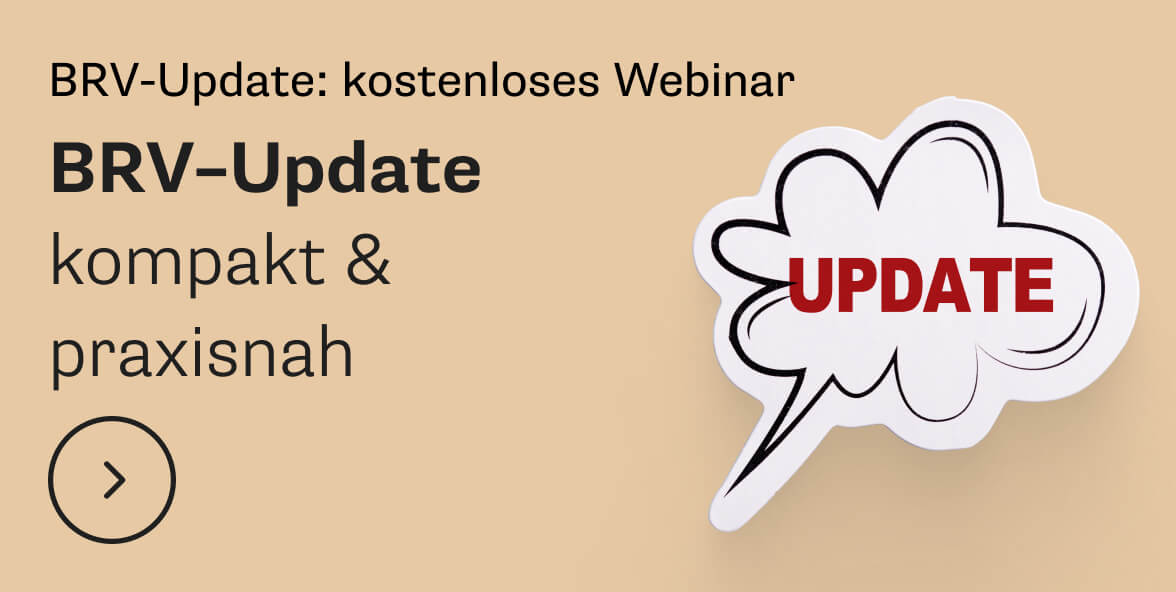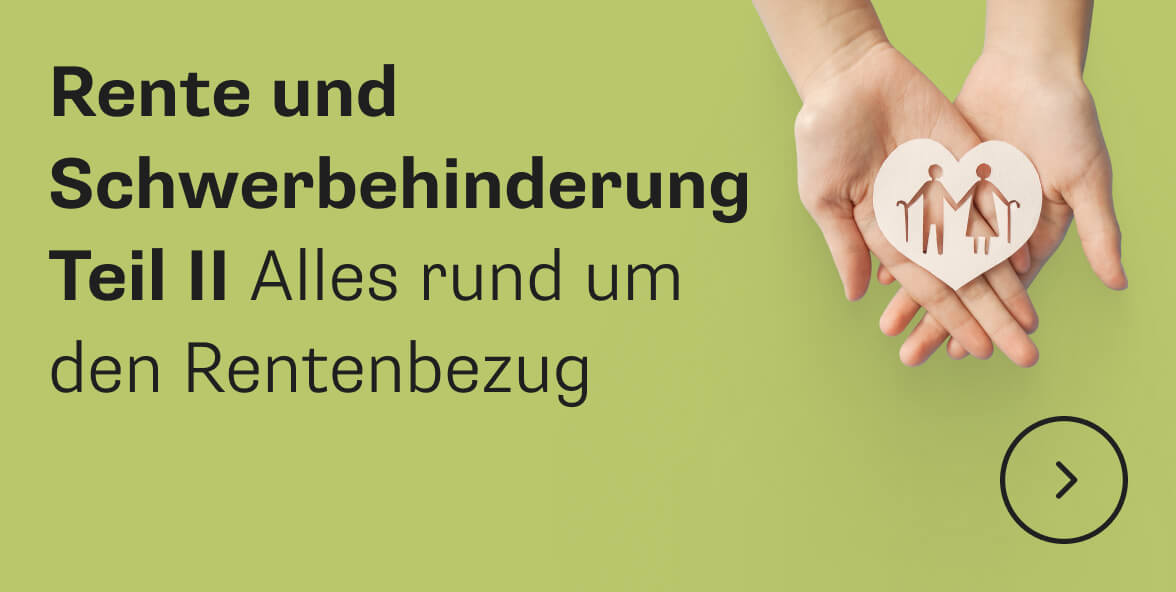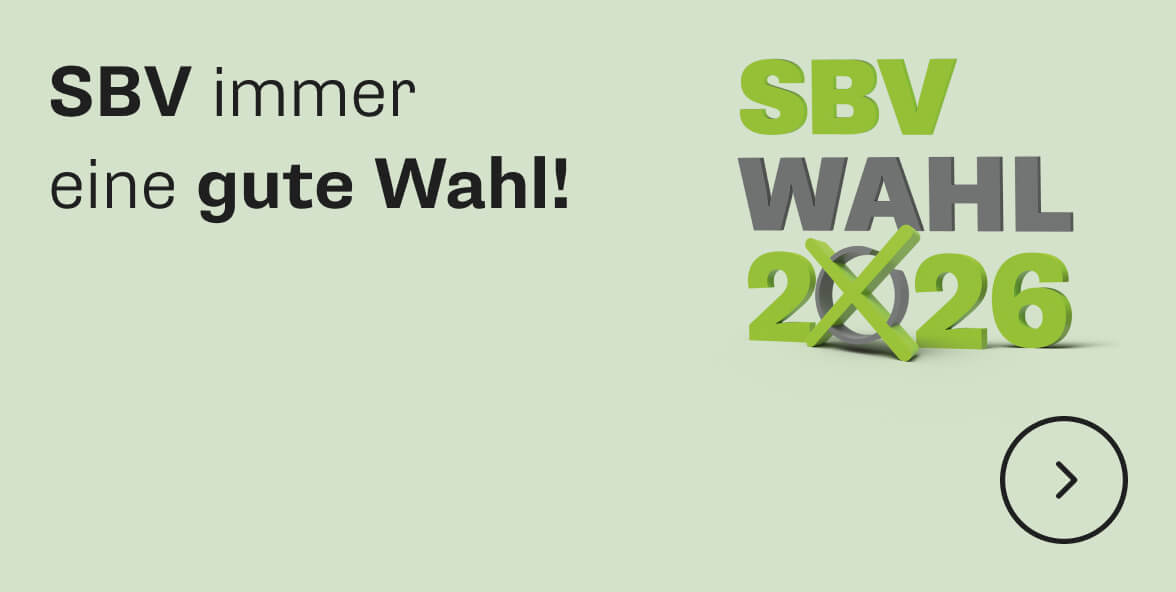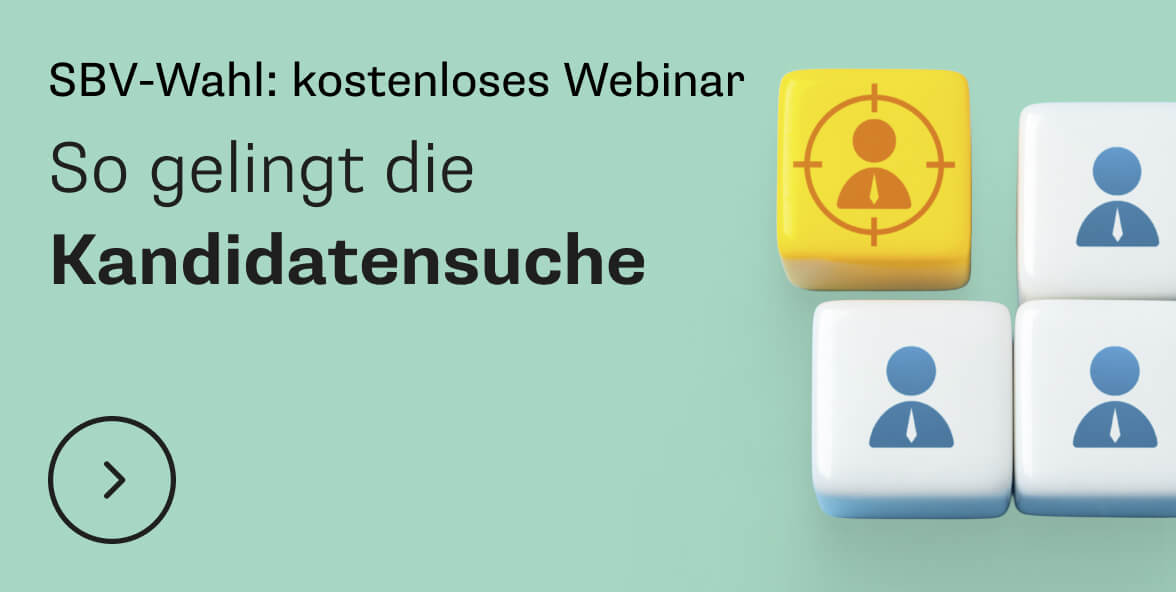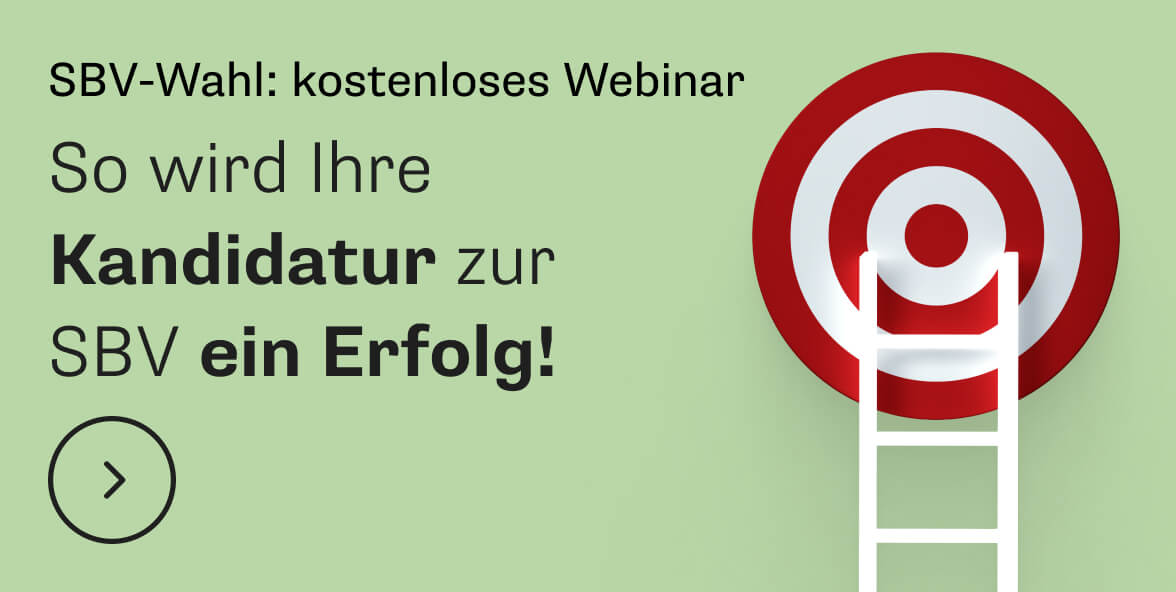Ein Land im Streik – wenn es sein muss
Finnland ist nicht gerade als Land der Revoluzzer bekannt, eher als Champion der Gelassenheit. Immerhin war Finnland auf Platz 1 des World Happiness Report 2024 – also das glücklichste Land.
Doch Anfang 2024 war Schluss mit der Ruhe und den Glücksgefühlen: Rund 300.000 Beschäftigte beteiligten sich an einem landesweiten Generalstreik, organisiert vom größten Gewerkschaftsbund SAK. Anlass waren geplante Arbeitsmarktreformen der finnischen Regierung, die unter anderem das Streikrecht beschneiden, Sozialleistungen kürzen und bezahlte Krankentage einschränken sollten. Vom Streik betroffen waren unter anderem Flughäfen, der öffentliche Verkehr, Kitas, Häfen und Energieversorger. Kurzum: Das Land stand still.
Das Signal war klar: Wer an Arbeitnehmerrechten sägt, muss mit breitem Widerstand rechnen – auch im sonst so pragmatischen Norden.
Wehrhafte Arbeitnehmer? Hört sich für deutsche Mitbestimmungsfreunde gut an.
Keine Betriebsräte – und trotzdem gut vertreten
Wehrhafte Arbeitnehmer? Hört sich für deutsche Mitbestimmungsfreunde gut an. Allerdings gibt es den klassischen Betriebsrat, wie wir ihn aus dem Betriebsverfassungsgesetz kennen, in Finnland nicht. Und doch sind Arbeitnehmer dort keineswegs auf sich allein gestellt.
Das Mitbestimmungssystem in Finnland basiert vor allem auf Vereinbarungen zwischen Unternehmensleitung und Arbeitnehmervertretung – meist in Form gewerkschaftlich organisierter Vertrauenspersonen. Eine gesetzlich festgelegte Struktur gibt es nur in Grundzügen, dafür aber mit erstaunlich viel Macht.
In Unternehmen mit mindestens 150 Beschäftigten haben Arbeitnehmer das Recht, Mitbestimmung aktiv einzufordern.
Gesetzlich geregelt: mitreden ab 150 Mitarbeitern
Ein zentrales Gesetz aus dem Jahr 1990 sieht vor: In Unternehmen mit mindestens 150 Beschäftigten haben Arbeitnehmer das Recht, Mitbestimmung aktiv einzufordern. Dabei geht es nicht um Mitbestimmung „light“, sondern um echte Beteiligung:
Kommt es zu keiner freiwilligen Vereinbarung, kann die Belegschaft ein Viertel der Sitze in einem Leitungs- oder Aufsichtsorgan des Unternehmens beanspruchen. Ob das der Vorstand oder der Aufsichtsrat ist, entscheidet das Unternehmen.
Diese Vertreter haben die gleichen Rechte und Pflichten wie andere Mitglieder – ein klarer Unterschied zum deutschen Modell, in dem Arbeitnehmervertreter meist als Gegengewicht zur Unternehmensseite agieren.
Das Herzstück der finnischen Mitbestimmung schlägt in den Gewerkschaften.
Gewerkschaften als Schlüsselakteure
Das Herzstück der finnischen Mitbestimmung schlägt in den Gewerkschaften. Mit einem Organisationsgrad von rund 74 Prozent gehören sie zu den stärksten Arbeitnehmervertretungen Europas.
In Finnland übernehmen Gewerkschaften nicht nur Tarifverhandlungen, sondern sind auch tief in die betriebliche Mitbestimmung eingebunden. Sie nominieren häufig die Kandidaten für Unternehmensgremien und führen die Gespräche über Mitwirkungsrechte und Arbeitsbedingungen.
Die drei großen Dachverbände – SAK, STTK und AKAVA – decken unterschiedliche Beschäftigtengruppen ab, von Industriearbeitern über Angestellte bis hin zu Akademikern. Gemeinsam gestalten sie die Regeln der betrieblichen Mitwirkung – oft in enger Zusammenarbeit mit den Arbeitgebern und dem Staat.
Es gibt kein einheitliches, gesetzlich vorgeschriebenes Wahlverfahren für Arbeitnehmervertretungen.
Flexibel statt gesetzlich geregelt
Ein wesentlicher Unterschied zur deutschen Betriebsratswahl: Es gibt kein einheitliches, gesetzlich vorgeschriebenes Wahlverfahren für Arbeitnehmervertretungen. Die Ausgestaltung der Mitbestimmung – von der Wahl der Vertreter bis hin zu ihren Rechten – wird betrieblich vereinbart, meist im engen Schulterschluss mit den Gewerkschaften.
Diese Flexibilität erlaubt maßgeschneiderte Lösungen, kann aber auch dazu führen, dass Mitbestimmung in kleinen oder gewerkschaftlich schwachen Betrieben unterentwickelt bleibt.
Zwischen Dialog und Arbeitskampf
Trotz der kooperativen Struktur verstehen sich finnische Gewerkschaften nicht als „brave Partner“. Wenn nötig, greifen sie auch zu härteren Mitteln – wie der große Generalstreik im Februar 2024 eindrucksvoll zeigte.
Auch in anderen Branchen kommt es regelmäßig zu Arbeitskämpfen: So legten Bäckereien und Lebensmittelbetriebe im Frühjahr 2025 die Arbeit nieder, um höhere Löhne und bessere Nachtarbeitszuschläge durchzusetzen – mit Erfolg.
Das Besondere: Auch nach einem harten Arbeitskampf kehren Gewerkschaften und Arbeitgeber meist schnell zum Dialog zurück. Sozialpartnerschaft bedeutet in Finnland nicht Kuschelkurs, sondern Verlässlichkeit auf Augenhöhe.
Fazit: Mitbestimmung mit nordischem Pragmatismus
Finnlands Mitbestimmungssystem zeigt, dass es auch jenseits deutscher Betriebsratsmodelle funktionierende Arbeitnehmervertretung geben kann – vorausgesetzt, die Gewerkschaften sind stark und gut organisiert.
Die finnische Lösung setzt auf Verhandlung statt Vorschrift, auf Kooperation statt Konfrontation. Doch wenn die rote Linie überschritten wird, kann Finnland auch streiken wie kaum ein anderes Land Europas. (sw)